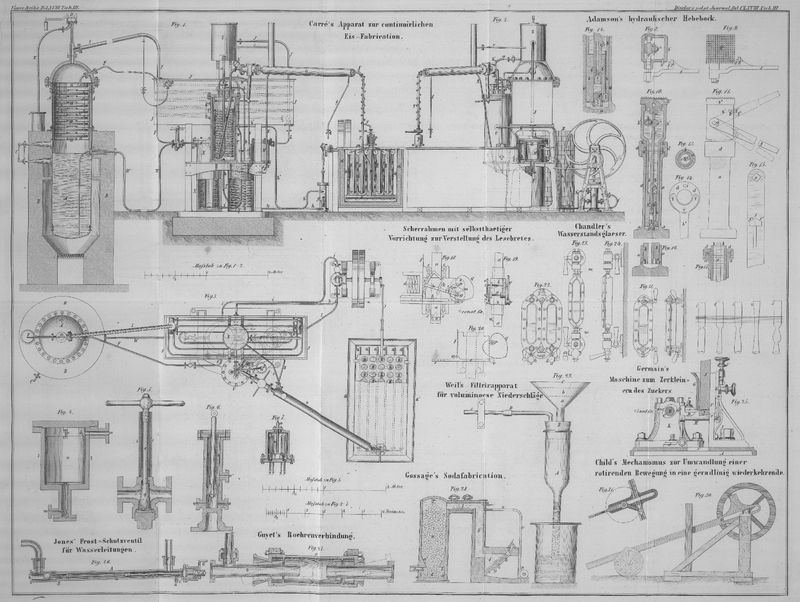| Titel: | Scherrahmen mit selbstthätiger Vorrichtung zur Verstellung des Lesebretes; von Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. |
| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. LI., S. 168 |
| Download: | XML |
LI.
Scherrahmen mit selbstthätiger Vorrichtung zur
Verstellung des Lesebretes; von Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart.
Aus dem württembergischen Gewerbeblatt, 1863, Nr.
12.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Scherrahmen mit selbstthätiger Vorrichtung zur Verstellung des
Lesebretes.
Die Vorrichtung zur Verstellung des Lesebretes ist unter Hinweglassung der bekannten
Theile des Scherrahmens durch die Figuren 18 und 19 in
Front- und Seitenansicht dargestellt. Das auf gewöhnliche Weise angeordnete
Lesebret d ist mit einer vierkantigen Hülse (Gangführer)
d verbunden, welche die vor dem Scherrahmen
angebrachte senkrechte Säule a umfaßt und an derselben
auf bekannte Weise unter Mitwirkung der vier Rollen c
auf- und abwärts geführt wird. Der mit der Hülse b verbundene Mechanismus dient nun dazu, die Höhenlage des Lesebretes nach
jedem Auf- und Niedergang um eine kleine Größe zu verändern, damit die
Fadenwindungen sich nicht über-, sondern regelmäßig nebeneinander legen.
Auf der vorderen Fläche der Hülfe b befindet sich ein um
die Welle g drehbarer Hebel h, welcher bei k einen nach innen gegen die
Säule a. gerichteten Stift von solcher Länge trägt, daß
derselbe in der tiefsten Stellung des Apparates mit dem am Ständer a in 2' Höhe über dem Fußboden angebrachten Daumen u in Berührung kommen muß. Durch den Widerstand des
Daumens u wird der Hebel h
gezwungen, eine Bewegung nach aufwärts zu machen, wobei der oben genannte Stift in
einem bogenförmigen Schlitz k sich bewegt; gleichzeitig
wird die mit h verbundene Schiebeklinke t auf das Klinkrad m
einwirken und eine entsprechende Drehung desselben herbeiführen, welche durch das
Trieb n und das Rad o auf
die mit der Welle p verbundene als Neoide geformte
Hebescheibe q übertragen wird. Letztere liegt auf der
hinteren Seite der Hülse b und wirkt auf eine Rolle r, welche, wie Fig. 20 zeigt, am Ende
des um s drehbaren, bei w
mit der Hebekette f verbundenen Hebels e angebracht ist. Jede Veränderung der Stellung von r hat sonach eine Veränderung der Stellung des Punktes
w oder der Höhenlage des Lesebretes zur Folge. Die
Größe dieser Veränderung kann man auf zweifache Weise reguliren. Man kann erstlich
die Drehung des Klinkrades bei jedem Hub vergrößern oder verkleinern, je nachdem man
den Hebel h einen längeren oder kürzeren Bogen
zurücklegen läßt. Um diese Veränderung herbeizuführen, hat man nur nöthig, den auf dem Bogen i gleitenden Endpunkt des Hebels h in tieferer oder höherer Lage durch Einsteckung eines Stiftes in die
daselbst vorhandenen Löcher aufzuhalten. Man kann aber auch zweitens noch die
Einwirkung der Hebescheibe q auf den Anschlußpunkt w der Hebekette f ändern,
indem man die Drehachse s des Hebels e wechselt, was bei dem Vorhandenseyn mehrerer Löcher
bei s leicht möglich ist. Durch gleichzeitige Benützung
beider Regulirungsvorrichtungen kann jede gewünschte Feinheit in der Stellung auf
vollkommenste Weise erreicht werden. Zu bemerken ist noch, daß der Daumen u beim Aufgang des Apparates sich aufklappt, mithin den
am Hebel h angebrachten Stift ungehindert vorbeigehen
läßt.
Ein mit dieser Regulirungsvorrichtung versehener, von Diepers und Nolden in Crefeld bezogener
Scherrahmen ist seit einiger Zeit in der Stuttgarter Webschule aufgestellt und hat
sich hier in jeder Beziehung durchaus praktisch bewährt. Der Scherrahmen hat eine
Höhe von 6 1/2 Fuß, einen Umfang von 7 brabanter oder circa 8 württembergischen Ellen und kostet einschließlich eines
Spulengestells zu 48 Spulen in der Fabrik 80 Thlr.
Tafeln