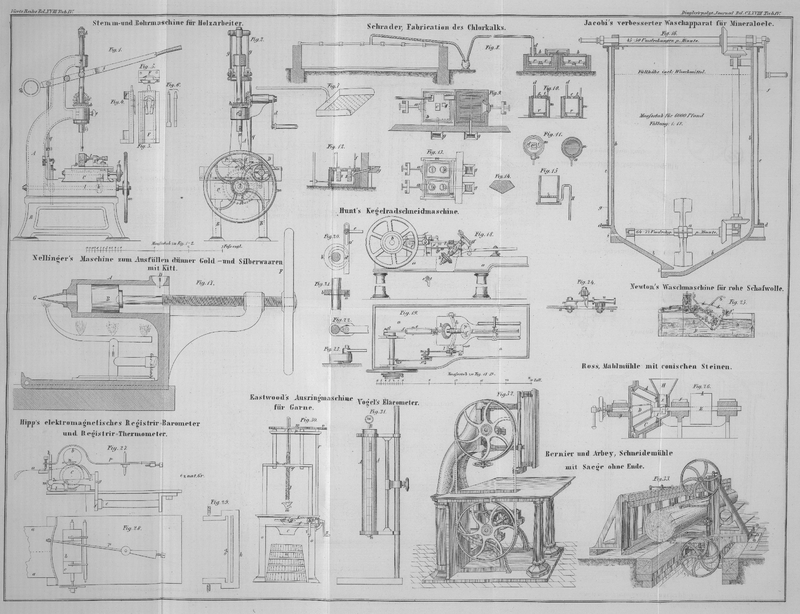| Titel: | Mahlmühle mit conischen Steinen; als Mittheilung patentirt für J. Roß in London. |
| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. LXXII., S. 256 |
| Download: | XML |
LXXII.
Mahlmühle mit conischen Steinen; als Mittheilung
patentirt für J. Roß in
London.
Aus dem London Journal of arts, Februar 1863, S.
84.
Mit einer Abbildung auf Tab. IV.
Roß' Mahlmühle mit conischen Steinen.
Bei dieser Mühle (patentirt in England am 29. April
1862) geschieht das Mahlen des Getreides zwischen zwei in einander
gesteckten conischen Flächen, von denen die äußere fest ist und die innere die
drehende Bewegung hat. Die äußere conische Mahlfläche besteht aus Steinstücken,
welche in einem conischen, gußeisernen Mantel gut befestigt sind. Die Anwendung
mehrerer Steinstücke, statt eines einzigen, geschieht der Billigkeit wegen und um
die Auswechselung zu erleichtern. Der gußeiserne Mantel besteht entweder aus dem
Ganzen oder ist aus zwei Hälften zusammengesetzt, welche mittelst Flantschen und Schrauben
mit einander verbunden sind, und ruht auf einem festen Gestelle. Innerhalb dieses
festen Steins dreht sich der conische Läufer, welcher unmittelbar auf der Treibwelle
befestigt ist.
Figur 26
zeigt den Durchschnitt dieser Mahlmühle. Der gußeiserne Mantel A des festen Steins hat an beiden Enden nach innen
vorspringende Flantschen a und b, von denen die letztere unten auf 5 bis 6 Zoll Länge ausgebrochen ist.
Innen ist der Mantel mit Steinsegmenten c ausgekleidet,
welche so behauen sind, daß sie nicht nur ihrer Länge nach den Raum zwischen den
Flantschen a und b
ausfüllen, sondern auch genau neben einander passen. Das letzte Segmentstück,
welches gerade die Breite der Aussparung an der Flantsche b hat, schließt, wie der Schlußstein eines Gewölbes, die Steinbekleidung
ab. Die Fugen zwischen den Steinen unter einander, sowie zwischen den Steinen und
dem Mantel werden mit Cement oder Gyps verstrichen, um das Losewerden der
Steinbekleidung beim Behauen, welches sogleich nach dem Erhärten des Bindemittels
vorgenommen wird, zu verhindern. Um die conischen Mahlflächen genau auf einander
passend zu machen, legt man nun den Läufer D, welcher
aus einem einzigen Steine besteht ein, und schleift die beiden Flächen mit Sand und
Wasser auf einander ab. Dann nimmt man den Läufer wieder heraus und haut in beide
Mahlflächen die Nillen ein.
Das weite Ende des Conus wird durch einen Deckel C
verschlossen, und der Eisenmantel ruht auf einem Fundament B, welches zugleich die Lager f, f für die
Treibwelle E des Läufers aufnimmt. Die Welle ist in
ihren Lagern nach der Achsenrichtung verschiebbar, und hat in der an den Deckel C angegossenen Büchse g noch
eine dritte Auflagerung, von welcher die Verschiebung der Welle, also auch die
Stellung der Steine ausgeht. Hierzu dient die Schraube G, welche durch einen Hebelarm in Umdrehung gesetzt und mittelst des Handrades
h fest eingestellt wird.
Der Trichter H, in welchen das Getreide aufgegeben wird,
mündet unten in eine Kammer I, durch welche die Welle
E hindurch geht; diese Kammer ist nach der Seite
hin, auf welcher die Steine liegen, offen, wird aber von einem breiten Bundring i an der Welle E beinahe
ganz ausgefüllt. Der Bundring i hat eine geneigt gegen
die Achse eingeschnittene Nuth, in welcher das Getreide während der Drehung des
Ringes an der eingeschobenen Wand x vorüber niederwärts
geführt wird. Die Speisung wird dadurch continuirlich und constant. Die Menge des
zugeführten Getreides wird durch die Lage der Wand x
gegen den Ring i regulirt; dieselbe ist veränderlich und
wird für jeden besonderen Fall durch Anziehen einer Preßschraube festgestellt. Das
Mahlgut wird durch den
Canal K abgeführt; alle übrigen Theile sind so gestellt,
daß ein Entweichen des Mahlguts nicht möglich ist. L ist
die Riemenscheibe zum Betriebe der Welle E mit dem
Läufer D.
Tafeln