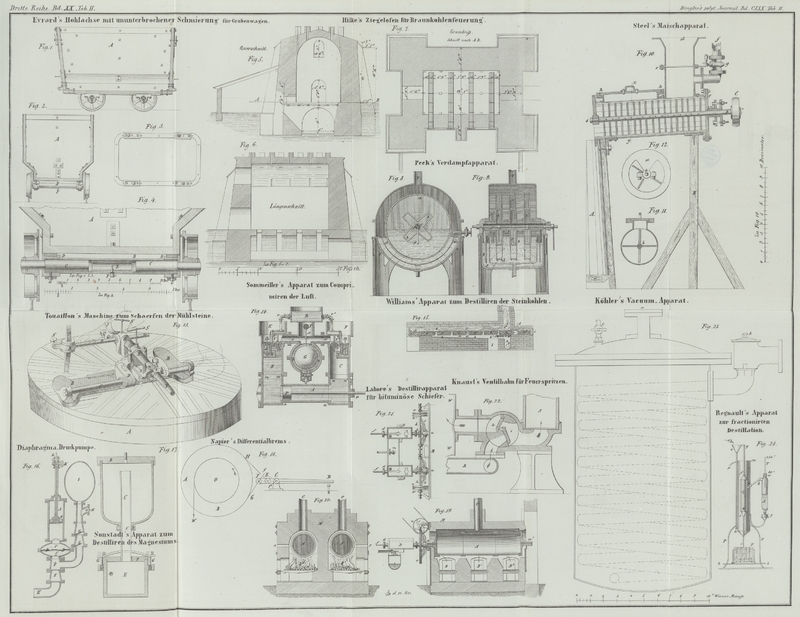| Titel: | Verfahren zur Reinigung oder Destillation des Magnesiums; von Ed. Sonstadt. |
| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. XXXVIII., S. 115 |
| Download: | XML |
XXXVIII.
Verfahren zur Reinigung oder Destillation des
Magnesiums; von Ed.
Sonstadt.
Aus der Chemical News, 1863, Nr. 189.
Mit einer Abbildung auf Tab. II.
Sonstadt's Verfahren zur Reinigung oder Destillation des
Magnesiums.
Wie ich in meiner früheren Mittheilung (polytechn. Journal Bd. CLXIX S. 442) bemerkt habe, stelle ich
zur Gewinnung des Magnesiums wasserfreies Chlormagnesium-Natrium dar, indem
ich die Lösung von Chlormagnesium im Gemisch mit Kochsalz eindampfe und schmelze;
das erhaltene Chlormagnesium-Doppelsalz zersetze ich dann in einem
schmiedeeisernen Tiegel durch Natrium.
Seitdem habe ich gefunden, daß bei der Bereitung des Doppelsalzes das Kochsalz
vortheilhaft durch Chlorkalium ersetzt werden kann.
Um das durch Zersetzung des Chlormagnesium-Doppelsalzes mit Natrium erhaltene
rohe Magnesium zu reinigen, destillire ich es in einem besonderen Apparat. Derselbe
besteht aus zwei, durch ein Rohr oder Canäle mit einander verbundenen Gefäßen; diese
Gefäße müssen beide für die Dauer des Destillationsprocesses luftdicht geschlossen
werden. Das eine derselben, welches das rohe Magnesium enthält, wird in einem Ofen
angebracht und mit dem Brennmaterial umgeben; das andere Gefäß befindet sich
unmittelbar darunter außerhalb des Ofens. Nachdem das rohe Magnesium in das obere
Gefäß gebracht und der Apparat luftdicht geschlossen worden ist, leitet man einen
Strom trockenes Wasserstoffgas durch die beiden Gefäße, zu welchem Zweck in jedem
derselben eine kleine Oeffnung gelassen wurde. Wenn sämmtliche Luft durch das Gas
ausgetrieben ist, verschließt man diese Oeffnungen durch Eintreiben von
Stahlpfropfen, läßt jedoch in dem Pfropf des unteren Gefäßes eine sehr kleine
Oeffnung, damit, wenn der Apparat erhitzt wird und das Gas sich ausdehnt, der
Ueberschuß desselben entweichen kann. Letztere Oeffnung kann durch einen genau
hineinpassenden Draht geschlossen werden.
Nachdem der Apparat beschickt und vorgerichtet ist, zündet man das Feuer um das obere
Gefäß herum an, und entzündet das aus der erwähnten kleinen Oeffnung entweichende
Wasserstoffgas, welches man so lange brennen läßt, bis es von selbst verlöscht,
wornach man die Oeffnung mittelst des Drahtes verschließt. Das untere Gefäß wird
während des Processes äußerlich mit Wasser abgekühlt. Das Gefäß, welches das Magnesium enthält, muß
auf eine sehr helle Rothglühhitze, nahezu auf die Weißglühhitze gebracht und diese
Temperatur so lange unterhalten werden, bis das untere Gefäß dessenungeachtet kühler
wird als es am Anfang des Processes war.
Nach beendigter Operation nimmt man den Apparat aus dem Ofen und läßt ihn erkalten;
wenn man ihn dann auseinander nimmt, wird man das Magnesium als eine mehr oder
weniger feste Masse im unteren Gefäße finden.
In der Abbildung des Apparates, Fig. 17, bezeichnet A einen schmiedeeisernen Tiegel; B ist der auf denselben geschraubte schmiedeeiserne Deckel; C, C ist ein schmiedeeisernes Rohr, welches den Tiegel
mit dem Condensator verbindet und bei D luftdicht in den
Tiegel geschraubt ist.
E ist der schmiedeeiserne Condensator mit einem Loch e von 1/4 Zoll Durchmesser, welches mit einem eisernen
Pfropf verschlossen wird; F ist der auf den Condensator
mittelst Schraubenbolzen G befestigte Deckel.
Tafeln