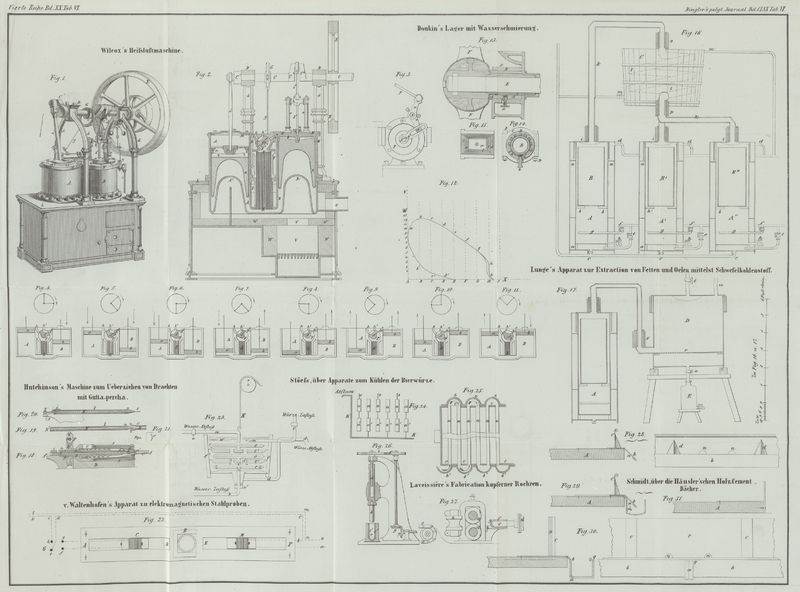| Titel: | Ueber einen Apparat zu elektromagnetischen Stahlproben; von Prof. Dr. A. von Waltenhofen in Innsbruck. |
| Autor: | Adalbert Waltenhofen [GND] |
| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. XCVI., S. 346 |
| Download: | XML |
XCVI.
Ueber einen Apparat zu elektromagnetischen
Stahlproben; von Prof. Dr. A. von Waltenhofen in Innsbruck.
Mit einer Abbildung auf Tab. VI.
v. Waltenhofen, über einen Apparat zu elektromagnetischen
Stahlproben.
Ich habe kürzlich in diesem JournalSeite 201 in diesem Bande. ein neues Verfahren angegeben, um die Härtegrade verschiedener Stahlsorten
zu bestimmen. Die Beschreibung des Apparates versprach ich nachträglich
mitzutheilen, weil ich bei der Abfassung jener Notiz eben keine Zeichnung zur Hand
hatte.
Die vorliegende Mittheilung hat nun den Zweck, meinen früheren Aufsatz über diesen
Gegenstand mit der Beschreibung des Apparates zu ergänzen, dessen ich mich bei
meinen Stahluntersuchungen bedient habe, mit den nöthigen Andeutungen über den
Gebrauch desselben. Dabei werde ich jedoch nicht das umständliche Verfahren
erörtern, welches ich anwenden mußte um meine Methode wissenschaftlich zu begründen,
sondern vielmehr ein vereinfachtes Verfahren beschreiben, welches in jenen Fällen
genügt, wo es sich nur um die praktische Anwendung und Benützung dieser Methode
handelt.
Der wesentlichste Theil meines Apparates ist in Fig. 22 abgebildet.
In der Mitte des beiderseits rahmenförmig ausgeschnittenen und mit Stellschrauben
versehenen Bretes A, F ist eine sehr sorgfältig
gearbeitete Bussole B aufgestellt, mit einer 9
Centimeter langen Balkennadel. Westlich davon befindet sich die
Magnetisirungsspirale M. Diese ist bei meinem Apparate
91 Millimeter lang; ihr innerer Durchmesser beträgt 30 Millimeter, der äußere 73 Millimeter; sie
besteht aus sechs Lagen 3 Millimeter dicken doppelt übersponnenen Kupferdrahtes von
je 24, also im Ganzen 144 Windungen. Sie ruht in einem passend ausgeschnittenen und
im Schlitze E, F verschiebbaren Schlitten. Oestlich von
der Bussole befindet sich, ebenso in einem Schlitten ruhend, eine zweite Spirale C, welche die Compensations-Spirale heißen mag,
und durchaus genau ebenso beschaffen ist wie die beschriebene Magnetisirungsspirale.
Zur Einstellung der Schlitten, welche mit Marken versehen sind, dient eine auf das
rahmenförmige Bret aufgetragene und von der Mitte aus nach beiden Seiten hin
numerirte Maaßstab-Theilung. Bei G befindet sich
ein aus Quecksilbernäpfen und dicken Drahtbügeln hergestellter Stromwechsler. Durch
denselben kann die Compensationsspirale nach Belieben entgegengesetzt oder
übereinstimmend mit der Magnetisirungsspirale verbunden oder auch ganz aus der
Stromleitung ausgeschaltet werden. Die Anordnung der punktirt gezeichneten
Stromleitungsdrähte ist in der Zeichnung zur besseren Uebersicht nur schematisch
angedeutet, und muß so ausgeführt werden, daß sie auch bei Anwendung der stärksten
Ströme keine Spur einer störenden Wirkung auf die Bussole äußert. Bekanntlich
vereinigt man, wenn die Drähte gut isolirt sind, die zusammengehörigen Hin-
und Rückleitungen, soweit es die Anordnung des Apparates gestattet, in einen Strang,
damit die magnetische Fernwirkung der einen Leitung durch die entgegengesetzte und
gleichstarke der anderen aufgehoben werde. Westlich von diesem Apparate und in
solchen Entfernungen, daß keine gegenseitige Störung der Instrumente stattfinden
kann, befinden sich die zur Messung und Regulirung des Stromes dienenden Apparate,
ferner noch ein Stromwechsler und endlich die Stromquelle selbst. Diese bestand bei
meinen Versuchen aus zwei doppelten Kohlen-Zink-Elementen, und muß bei
jedem Apparate natürlich mit Rücksicht auf die vorhandenen Leitungswiderstände
passend gewählt und combinirt werden. Zur Messung der Stromintensitäten eignet sich
am besten eine Tangentenbussole. Zur Stromregulirung ist, nebst einer Anzahl passend
angeordneter Widerstandsrollen, noch ein Rheostat zur Ausgleichung der kleineren
Differenzen erforderlich. Um denselben bequem handhaben zu können, während man
gleichzeitig an der Tangentenbussole beobachtet, ist ein Rheostat mit Schraubenwalze
zu empfehlen. Die Widerstandsrollen kann man sich entweder durch passend angeordnete
Quecksilbernäpfe und dicke Drahtbügel zweckmäßig verbinden, oder nach Art der
Widerstandssäule von Eisenlohr oder des Stöpselapparates
von Siemens und Halske.
Bei meinem Apparate war zwischen k und l noch eine zweite, östlich aufgestellte
Tangentenbussole eingeschaltet. Diese ist aber für gewöhnlich nicht nöthig und es können daher
die Drahtenden k und l
unmittelbar mit einander verbunden werden. Die Meßinstrumente, von welchen soeben
die Rede war, müssen zur Vermeidung von Erschütterungen auf Unterlagen placirt seyn,
welche, ohne Verbindung mit dem Boden, an den Wänden festgemacht sind.
Die Stromleitung geschieht auf dem Wege aMbcdegCfhiklmno.....a, wobei also zwischen o
und a die oben aufgezählten westlich aufgestellten
Apparate eingeschaltet sind. Die Compensationsspirale C
muß durch entsprechende Stellung des Stromwechslers G so
eingeschaltet seyn, daß ihre Wirkung auf die Bussole B
derjenigen gerade entgegengesetzt ist, welche die
Magnetisirungsspirale M auf die Bussole B ausübt. Bei meinen Versuchen war die Mitte der
Magnetisirungsspirale genau 380 Millimeter von der Mitte der Bussole B entfernt. Man kann diese Entfernung füglich
beibehalten und die Magnetisirungsspirale dann ein für allemal feststellen, indem
man den Schlitten in welchem sie ruht, auf eine passende Art festklemmt, was z.B.
mit einer durch die Rahmenleiste seitwärts eingeführten messingenen Bremsschraube bewerkstelligt werden kann. Wenn dieß geschehen
ist, muß die Compensationsspirale C so eingestellt
werden, daß sie die Wirkung, welche die Magnetisirungsspirale M auf die Bussole B ausübt, vollkommen neutralisirt. Diese Stellung läßt sich daran
erkennen und erproben, daß die Bussolennadel B
vollkommen ruhig bleibt, wenn man die Verbindung mit der galvanischen Batterie
abwechselnd unterbricht und wieder herstellt. Es ist rathsam zu dieser Probe, welche
vor jeder Untersuchung sorgfältig wiederholt werden
muß, sehr starke Ströme anzuwenden. Der ganze Apparat muß natürlich ursprünglich so
aufgestellt werden, daß die Nadel der Bussole B genau
auf dem Nullpunkt einsteht.
Wenn der Apparat auf die beschriebene Art vorbereitet und rectificirt worden ist,
wird der Strom unterbrochen und das zu untersuchende Stahlstäbchen so in die
Magnetisirungspirale M eingelegt, daß es beiderseits genau gleichweit aus der Spirale hervorragt. Wenn hierauf
ein Strom eingeleitet wird, zeigt die Bussole B eine
Ablenkung, welche offenbar nur vom magnetisch gewordenen Stäbchen herrühren kann,
weil ja die Spiralen M und C
bei der oben vorgeschriebenen Einstellung gar keine ablenkende Wirkung auf die
Bussole B äußern können.
Wenn der an der Bussole B beobachtete Ablenkungswinkel =
β ist, so kann man die Tangente dieses
Winkels β als Maaß des Stabmagnetismus ansehen;
ich will künftighin immer tang β = y, setzen. Der Strom, welcher diesen Stabmagnetismus
hervorgebracht hat, kann nun gleichzeitig an der Tangentenbussole gemessen werden.
Ist nämlich der an der Tangentenbussole beobachtete Ablenkungswinkel = α, so kann die Tangente desselben die Stromstärke vorstellen; ich
will künftighin immer tang α = x setzen.
Nach dem in meiner früheren Mittheilung aufgestellten Gesetze ist der Stabmagnetismus
mit der Potenz 4/3 der Stromstärke und mit der Potenz 3/4 des Stabgewichtes
proportional. Bezeichnet man daher das Gewicht des untersuchten Stahlstäbchens mit
g, so ergibt sich die Gleichung tang β = Cg3/4 (tang α)4/3 oder y = Cg3/4
x4/3, wobei C eine von der Beschaffenheit der Stahlsorte abhängige
Zahl ist. Um diese zu finden, hat man daher nach diesen Gleichungen nur immer den
Quotienten tang β/(g3/4(tang α)4/3) zu bestimmen. Es ist
jedoch, um sichere Resultate zu gewinnen, erforderlich, für jeden Stab mehrere
Versuche mit verschiedenen Stromstärken zu machen, sodann aus jedem Versuche den
Werth von C abzuleiten und hieraus den Mittelwerth von
C zu berechnen. Mit Hülfe der Widerstandsrollen und
des Rheostaten läßt sich die Stromstärke leicht so reguliren, daß sich die
aufeinanderfolgenden Werthe von x z.B. wie 1, 2, 3... 5
zu einander verhalten, und daß die kleinste dieser Stromstärken das Stäbchen
hinreichend magnetisirt, um an der Bussole B eine
meßbare Ablenkung hervorzubringen. Man beginnt also, sobald das Stahlstäbchen
eingelegt ist, mit dieser ersten Stromstärke und steigert dieselbe, ohne die Kette je zu unterbrechen, nach und nach auf die
höheren Abstufungen, jedoch immer mit der Vorsicht, daß die
entsprechenden Einstellungen an der Tangentenbussole nicht durch zu rasche
Verminderung des Widerstandes überschritten werden.
Die Resultate werden natürlich noch viel verläßlicher, wenn man von jeder Stahlsorte
zwei Stäbchen untersucht.
Alle Stäbchen, welche zu diesen Untersuchungen verwendet werden, müssen ganz genau gleich lang seyn und zwar ein wenig länger als
die Spirale; es dürfte am besten seyn, die Länge von 103 Millimetern beizubehalten,
welche ich bei meinen Versuchen immer angewendet hatte. Die passendste Dicke ist 3
bis 4 Millimeter, in keinem Falle dürfen die Stäbchen dicker seyn als 5 Millimeter.
Außerdem ist zu beobachten, daß die Stäbchen nothwendig
cylindrisch seyn müssen und in keinem Falle prismatisch seyn dürfen, weil
letztere, wie ich nachgewiesen habe, bei gleicher Stromstärke etwas weniger
Magnetismus zeigen, und überhaupt nicht so einfache Gesetze befolgen wie die
ersteren. Endlich dürfen zu diesen Untersuchungen des Härtegrades nur solche
Stäbchen verwendet werden, welche noch nie magnetisirt worden
sind, weil ein magnetisirter Stab, auch wenn er wieder entmagnetisirt worden ist, ein anderes
elektromagnetisches Verhalten zeigt als ein ursprünglich unmagnetischer. Je größer
der Werth von C für eine Stahlsorte ausfällt, desto
kleiner ist der betreffende Härtegrad; hat man z.B. für zwei zu vergleichende
Stahlsorten C und C₂
gefunden und sucht die betreffenden Härtegrade H₁
und H₂, so hat man die Proportion H₂ ÷ H₁
= C₁ ÷ C₂; nimmt man die Härte H₁ zur Basis
der Vergleichung und will die H₂ Härte H₂ Procenten ausgedrückt, so ist H₂ = 100 C₁/C₂. Diese Andeutungen und die
in meiner früheren Mittheilung enthaltenen theoretischen Bemerkungen genügen
vollkommen, um die Benützung des beschriebenen Apparates für praktische Zwecke klar
zu machen. In vielen Fällen wird sich die Sache noch viel einfacher gestalten.
Wenn es nicht darauf ankommt genaue Zahlenverhältnisse zu ermitteln, sondern nur
annähernd die Härtegrade zweier Stahlsorten zu vergleichen, so wird man sich mit ein
Paar Versuchen mit jeder Sorte begnügen können.
Es würde nicht schwer seyn, dem beschriebenen Apparate eine noch viel einfachere und
wohlfeilere Construction zu geben, doch würde dazu erst dann eine Veranlassung
vorhanden seyn, wenn diese Methode in weiteren Kreisen Beachtung und Anklang finden
sollte.
Innsbruck, am 4. November 1863.
Tafeln