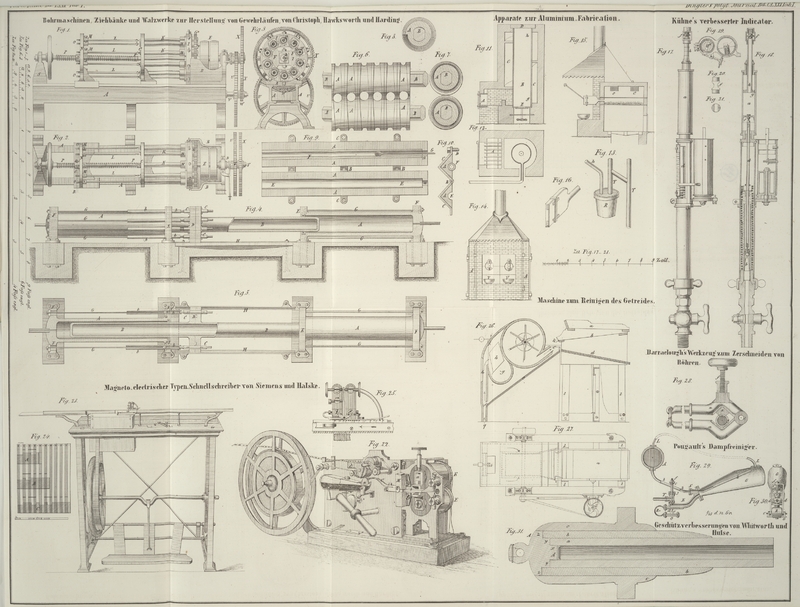| Titel: | Ueber Verbesserungen in der Aluminium-Fabrication; von A. Stevart. |
| Fundstelle: | Band 171, Jahrgang 1864, Nr. XIII., S. 51 |
| Download: | XML |
XIII.
Ueber Verbesserungen in der
Aluminium-Fabrication; von A.
Stevart.
Aus der Revue universelle des mines, 1863, t. XIV p.
61.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Stevart, über Verbesserungen in der
Aluminium-Fabrication.
Die Darstellung des Aluminiums hat in der Fabrik chemischer Producte zu Salyndre (Départem. du Gard) beträchtliche Fortschritte
gemacht, worüber ich im Folgenden berichten werde.
Die verschiedenen Operationen zur Darstellung des AluminiumsMan s. die Abhandlung von H. Sainte-Claire Deville
„über die Fabrication des Natriums und des Aluminiums“
im Jahrgang 1856 des polytechn. Journals, Bd. CXLI S. 303, 378 und
441.
zerfallen bekanntlich in
drei Gruppen: 1) Fabrication des Doppelsalzes von Chloraluminium und Chlornatrium;
2) Fabrication des Natriums; 3) Fabrication des Aluminiums durch Einwirkung dieser
beiden Körper.
I. Fabrication der Doppelverbindung von
Chloraluminium und Chlornatrium.
Die Fabrication dieses Doppelsalzes erheischt die Anwendung einer fast chemisch
reinen Thonerde; die Thonerde, welche bisher entweder mittelst
Ammoniak-Alauns oder käuflicher schwefelsaurer Thonerde dargestellt wurde,
ließ sowohl hinsichtlich der Gestehungskosten als der Reinheit viel zu wünschen
übrig.
Jetzt besitzt man ein schätzbares Mineral, welches durch zwei sehr einfache
Operationen reine Thonerde liefert. Dasselbe wird im Var
(im Gebirgspaß von Ollioulles, bei Toulon) bergmännisch gewonnen, und hat das
Ansehen einer breccienartigen Masse mit kleinen Theilen von bräunlichrother oder
schwärzlicher Farbe, welche in einem sehr feinen und compacten Cement von
ziegelrother Farbe zerstreut sind. Nach Balard's Analyse
ist die durchschnittliche Zusammensetzung dieses Minerals:
Thonerde
60
Eisenoxyd
25
Kieselerde
3
Wasser
12
–––
100
Vergleicht man diese Zusammensetzung mit der folgenden zweier Diaspore, wovon der eine rein, der andere aus Sibirien aber mit Eisen
gemengt ist, so sieht man, daß das in der Fabrik zu Salyndre benutzte Mineral dem
sibirischen Diaspor gleich kommt, wenn man den Eisengehalt des letzteren vermehrt
und seinen Thonerdegehalt vermindert.
ReinerDiaspor.
Diasporaus Sibirien.
Thonerde
85,10
74,66
Eisenoxyd
„
4,51
Kieselerde
„
2,90
Kalk- und Bittererde
„
14,58
Wasser
14,90
1,64
––––––––
––––––
100,00
98,29
Die sehr einfache Behandlung, wodurch man dieses Mineral von seinem Eisen- und
Kieselerdegehalt befreit, ist folgende:
Nachdem es unter einem verticalen Mahlstein in feines Pulver verwandelt worden ist,
vermengt man es mit (wasserfreiem) kohlensaurem Natron und erhitzt das Gemenge auf
der Sohle eines Flammofens. Die Masse kommt dabei nicht zum Schmelzen und backt
sogar nicht zusammen, sondern die Verbindung erfolgt ohne daß das Gemenge seinen
Aggregatzustand verändert: man erhält so Thonerde-Natron (2
Al²O³, 3 NaO) und ein Doppelsilicat von Thonerde und Natron, gemengt
mit Eisenoxyd, Kieselerde und ein wenig Thonerde welche der Einwirkung entgieng.
Das Product läßt sich wegen des beibehaltenen pulverförmigen Zustandes mit der
größten Leichtigkeit mit Wasser behandeln. Dieses löst bloß das
Thonerde-Natron auf, während das Eisenoxyd und die Kieselerde im Rückstande
bleiben, ersteres im freien Zustande, letztere zum Theil als Doppelsilicat von
Natron und Thonerde.
Die früheren Verfahrungsarten hatten den großen Fehler, daß wegen der Unreinheit der
Thonerde ein wenig Eisen und Silicium in das Aluminium übergiengen und dessen
wichtigste Eigenschaften, seinen Glanz und seine Unveränderlichkeit,
beeinträchtigten.
Die ganz klare Auflösung von Thonerde-Natron decantirt man in einen
horizontalen Cylinder von Eisenblech, in dessen Achse sich ein Rührer mit Schaufeln
rasch umdreht und daher die Flüssigkeit in Form eines feinen Regens suspendirt.
Durch den unteren Theil des Cylinders zieht ein Strom Kohlensäure ein, welche aus
sehr reinem weißen Kalkstein mittelst Salzsäure entwickelt wird; das in einem großen
Kasten von Steinzeug erzeugte Kohlensäure-Gas zieht zuerst durch zwei
Waschflaschen, welche ein wenig Wasser enthalten und gelangt dann in den
Blechcylinder, wo es folgende Reaction veranlaßt,
2 Al²O³, 3 NaO + 3 CO² = 3 NaO, CO² +
2 Al²O³.
Die aus der Flüssigkeit durch die Kohlensäure gefällte Thonerde wird nach dem
Absetzen durch Decantiren gesammelt und mit warmem Wasser gewaschen, um ihr die
letzten Spuren von kohlensaurem Natron zu entziehen. Dieses Waschen geschieht sehr
sorgfältig auf großen Leinwandfiltern, welche über einen metallenen Kasten gespannt
sind, worin man ein starkes Saugen mittelst eines Wasserdampfstromes bewirkt. Nur
mittelst dieses Saugens ist die so langsame Operation des Filtrirens und Waschens
der gefällten Thonerde im Großen anwendbar. Man bedient sich auch einer
Schleudermaschine, deren Behälter mit Leinwand gefüttert ist, um mittelst der
Centrifugalkraft rasch eine große Wassermenge durch die Thonerde zu treiben.
Die erhaltenen Producte sind also: 1) eine Auflösung von kohlensaurem Natron, welche in die
Abdampfkessel der Fabrik zurückkehrt, so daß nur die geringe Menge Natron verloren
geht, welche sich mit Kieselerde verbunden hat; 2) ein sehr weißer Teig von reinem
Thonerdehydrat.
Das gewonnene Thonerdehydrat muß nun vollständig getrocknet und entwässert werden,
was in einem kleinen Flammofen geschieht, in welchen man es von der Consistenz eines
Mörtels bringt.
Die so erhaltene wasserfreie Thonerde vermengt man mit Kochsalz und Holzkohlenpulver,
befeuchtet das Ganze mit ein wenig Wasser und formt daraus faustgroße Klöße, welche
man in einem geheizten Local trocknet und dann in den Tiegel des zur Darstellung des
Doppelsalzes von Chlorcalcium und Chlornatrium dienenden Ofens bringt. Dieser Ofen
(Fig. 11,
12 und
13)
besteht aus einem Feuerherd A, dessen Flamme durch
spiralförmige Canäle C, C um einen großen Tiegel oder
Hafen B von feuerfestem Thon circulirt, welcher
senkrecht in der Mitte des Ofens angebracht ist. Der Tiegel, dessen obere Mündung
mit einem großen feuerfesten Ziegel D bedeckt wird,
welchen man gut mit Thon lutirt, besitzt drei Oeffnungen: die untere E, welche mit einem, durch eine Druckschraube gehaltenen
kleinen Ziegel verschlossen wird, dient zum Entleeren des Tiegels, nachdem das darin
enthaltene Material erschöpft ist; von zwei seitlichen Oeffnungen dient die untere
g zum Einleiten des Chlorgases und die obere h für den Austritt des Productes.
Das Chlorgas liefert eine Batterie von sechs Steinzeug-Bombonnes, durch
Einwirkung von Salzsäure auf Braunstein; dasselbe wird gewaschen und dann
getrocknet, entweder indem man es durch eine Bombonne streichen läßt, welche
concentrirte Schwefelsäure enthält, oder indem man es über Chlorcalcium leitet,
welches man als Nebenproduct der Kohlensäurebereitung gewinnt. Indem das Chlorgas
bei hoher Temperatur auf mit Kohle gemengte Thonerde einwirkt, entsteht bekanntlich
Chloraluminium, und da dieses im angewandten Gemenge Chlornatrium vorfindet, so
bemächtigt es sich desselben und erzeugt so Chloraluminium-Natrium, welches
durch die obere seitliche Oeffnung h entweicht und dann
in die außerhalb des Ofens angebrachte thönerne Vorlage R (Fig.
13) gelangt, worin es sich verdichtet.
Diese Vorlage hat die Gestalt eines Blumentopfes und ist mit einem Deckel versehen,
der das Eintrittsrohr h und das doppelt gekrümmte Rohr
T, T aufnimmt; durch letzteres zieht das
überschüssige Chlor und ein wenig verlorenes Chloraluminium in den Schornstein
ab.
Nach beendigter Operation findet man die Vorlage R mit
einer goldgelben
krystallinischen Masse gefüllt, welche Chloraluminium-Natrium ist.
II. Fabrication des
Natriums.
In der Fabrication des Natriums sind nur wenig Abänderungen gemacht worden. Man
erhält dasselbe bekanntlich durch die Einwirkung von Kohle auf kohlensaures Natron,
welches mit kohlensaurem Kalk versetzt ist. Die Operation wird in Cylindern von
genietetem Eisenblech vorgenommen, welche in einem besonderen kleinen Ofen (Fig. 14 und
15)
erhitzt werden.
Als Materialien wendet man Sodasalz (sel de soude),
Steinkohlenklein und einen schönen weißen Kalkstein an, welcher sehr rein ist und
fein pulverisirt wird. Das Gemenge füllt man in die zwei Blechcylinder, welche
horizontal im Ofen angebracht sind, wie Fig. 15 zeigt. Diese.
Cylinder werden durch zwei lutirte gußeiserne Deckel verschlossen, welche sich
außerhalb des Ofens befinden, damit sie nicht zu heiß werden. Der vordere Pfropf ist
mit einem Loch versehen, in welches der Hals der Vorlage dicht eingepaßt wird;
letztere ist die von Donny und Mareska angegebene. Fig. 16 stellt eine
Ansicht dieser Vorlage dar, welche aus zwei gußeisernen Platten besteht, wovon die
eine auf dem größten Theil ihres Umfangs mit erhabenen Rändern versehen ist, so daß
sie, mittelst Schließkeilen vereinigt, zwischen sich einen flachen leeren Raum
lassen, worin sich das Natrium verdichtet.
Die Cylinder liegen auf entsprechend behauenen Ziegeln, welche man (wenigstens die
oberen) für das Beschicken verstellen kann, und befinden sich ziemlich hoch über dem
Rost; ungeachtet dieser Vorsichtsmaßregeln nutzen sie sich sehr schnell ab, und
müssen nach einigen Beschickungen durch neue ersetzt werden. Sie haben 0,10 Met.
Durchmesser und 0,75 Met. Länge. Man zündet das Feuer auf dem Rost an und die
Verbrennungsproducte ziehen, nachdem sie die zwei Retorten beleckt haben, durch die
Feuercanäle c, c (Fig. 15) und dann in den
Kaminen A, A. (Fig. 14) hinab, welche in
einem, allen Oefen gemeinschaftlichen unterirdischen Canal ausmünden. Die
Destillation beginnt bald, und ein Arbeiter läßt nun mittelst eines eisernen Stabes
(Fig. 15)
das Natrium aus der Vorlage in zwei Schalen V, V
ausfließen, welche Schieferöl enthalten. Man sammelt es so in dem Maaße als es sich
verdichtet. Da sich das Oel sehr nahe am Ofen befindet, so ist es stets warm genug,
damit das Natrium den flüssigen Zustand beibehält.
Die über dem Natrium sich ansammelnde Krätze wird unter Schieferöl umgeschmolzen und
gibt eine neue Quantität Natrium. Man gießt das Natrium in kleine Brode von der Gestalt einer
abgestumpften Pyramide, deren jedes ungefähr 200 Gramme wiegt und die man unter
Schieferöl aufbewahrt.
III. Fabrication des
Aluminiums.
Die Schlußoperation, welche durch Einwirkung des Natriums auf das Doppelsalz von
Chloraluminium und Chlornatrium das Aluminium liefert, wird in einem Flammofen
ausgeführt; nachdem man das Doppelsalz hineingebracht hat, setzt man demselben
einige Brode (nämlich 5 per Kilogr.) zu, die man vorher
mittelst einer Schere in zwei oder drei Stücke zerschnitten hat. Endlich setzt man
den grönländischen Kryolith zu, welcher das einzige geeignete Flußmittel ist, weil er weder Kieselerde noch Eisen enthält.
Während der Beschickung des Ofens hat man dafür zu sorgen, daß die Natriumstücke von
den anderen Substanzen bedeckt sind und die Hitze nach und nach gesteigert wird.
Bald tritt eine so heftige Reaction ein, daß sie die Wände des Ofens und das
Material zum Rothglühen bringt, und letzteres wird dann vollkommen flüssig.
Ein Abstichloch gestattet zuerst die Schlacke abzuziehen, hernach das vollkommen
geschmolzene Aluminium, welches sich zu einer beiläufig 8 Kilogr. schweren Masse
vereinigt.
Die zuletzt abgeflossene graue Schlacke pulverisirt man, um dann durch Sieben die
wenigen Aluminiumkügelchen abzusondern, welche sie stets noch enthält.
Man braucht nun das Aluminium bloß noch in einem thönernen Tiegel umzuschmelzen,
welcher in einem Windofen erhitzt wird, um es in vollkommen reinem und verkäuflichem
Zustande zu erhalten.
Tafeln