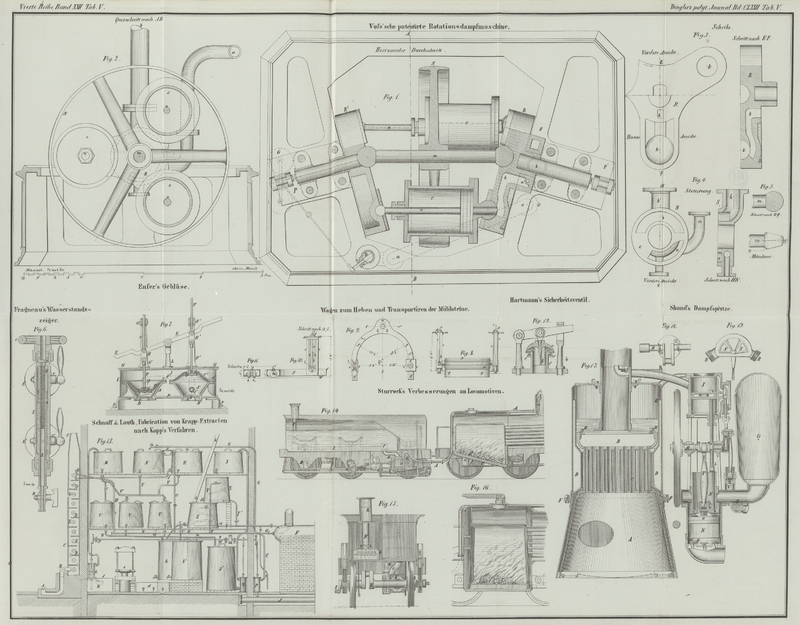| Titel: | Die Voß'sche Rotations-Dampfmaschine in Bezug auf ihre Construction und Leistungsfähigkeit; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |
| Autor: | Robert Schmidt |
| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. LIX., S. 241 |
| Download: | XML |
LIX.
Die Voß'sche
Rotations-Dampfmaschine in Bezug auf ihre Construction und Leistungsfähigkeit;
von Dr. Robert Schmidt,
Civilingenieur in Berlin.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Schmidt, über die Voß'sche Rotations-Dampfmaschine in Bezug
auf ihre Construction und Leistungsfähigkeit.
1. Die Construction.
Die in Rede stehende Maschine, welche von dem Ingenieur Hrn. W. H. Chr. Voß in Berlin construirt und demselben in allen Staaten
patentirt wurde, unterscheidet sich in Betreff ihrer Construction von den
gewöhnlichen Dampfmaschinen:
1) durch die Verminderung der Bewegungsmechanismen, wodurch in directester Weise eine
rotirende Bewegung erzeugt, sowie die Reibung vermindert wird;
2) durch die Beseitigung aller Stopfbüchsen, wodurch ebenfalls die Reibung vermindert
und somit der Betrieb erleichtert wird.
Die speciellere Construction derselben wird aus dem Nachfolgenden hervorgehen:
Zwei verticale Scheiben R und R', Fig.
1, 2
und 3 auf Tab.
V, sind in ihren Mitten auf horizontalen, in Lagern ruhenden Wellen auf gekeilt, und
schneiden sich die Ebenen dieser Scheiben verlängert unter einem gewissen Winkel. In
der Scheibe R sind radial drei Canäle k, k, k eingegossen, von denen jeder mit einem
Dampfcylinder C correspondirt. Die Verbindung zwischen
Cylinder und Scheibe ist einfach durch ein durchbohrtes Kugelscharnier
hergestellt.
In jedem der Cylinder bewegt sich ein Kolben n, welcher
ebenfalls mittelst Kugelscharniers mit der anderen, nicht mit Canälen versehenen
Scheibe R' in entsprechender Richtung verbunden ist, und
zwar in der Weise, daß die Achsen der Cylinder und Kolben horizontal mit einander
parallel laufen, wie das aus Fig. 1 ersichtlich ist.
Die Verbindungslinien der Kugelmittelpunkte beschreiben auf jeder Scheibe ein
reguläres Dreieck. Zu bemerken ist hier noch, daß die Anzahl der Cylinder sich
darnach richten wird, ob
die Maschine einen mehr oder weniger gleichmäßigen Gang haben soll. In der Scheibe
R münden nach dem Mittelpunkte zu die drei Canäle
k, k, k. Fig. 3 zeigt die vordere
und hintere Ansicht der Scheibe R. Sämmtliche Vierecke
k liegen in einer ebenen Fläche, gegen welche das
eigenthümlich geformte Stück S dampfdicht aufgeschliffen
ist. Seine Construction ist aus Fig. 4 und Fig. 1 zu ersehen, und in
folgender Weise ausgeführt. S ist ein, von einer Seite
geschlossener Hohlcylinder von geringer Höhe, welcher durch Stege in die drei
Kammern a, e und b
eingetheilt ist. Die Kammer a ist mit dem
Dampfeinströmungsrohre a, die Kammer b dagegen mit dem Dampfausströmungsrohre b verbunden. In diesen Hohlcylinder ist ein anderer
kleiner Cylinder eingegossen, durch welchen die Nabe der canalisirten Scheibe R geführt wird. Die vordere Fläche von S und die hintere Fläche der Scheibe R sind demnächst aufeinander geschliffen, und kann sich
also die Scheibe R um den festgelagerten Körper S drehen. Bei jeder beliebigen Stellung der Scheibe R wird ein Canal vor der Kammer a, des Schiebers liegen. Wird nun das Dampfabsperrventil D, welches in dem horizontalen Durchschnitt der
Maschine, Fig.
1, ersichtlich ist, geöffnet, so strömt der Dampf durch das Rohr a in die Kammer a des
Körpers S und von hier durch den, vor derselben
liegenden Canal k und das durchbohrte Kugelscharnier in
den Cylinder C, woselbst er sowohl gegen den Kolben n, als auch gegen den Boden des Cylinders einen Druck
ausübt. Durch diesen Druck wird eine Drehung beider Scheiben veranlaßt, wodurch ein
folgender Canal der Scheibe R vor die Kammer a geführt, somit eine weitere Drehung der Scheiben
bewirkt, und auf diese Weise eine permanente direct rotirende Bewegung
hervorgebracht wird. Bei der Drehung der Scheiben R und
R' verläßt jeder der Canäle die Kammer a, nachdem er einen Winkel von 120° durchlaufen
hat und gelangt vor die Expansionsfläche e, also in dem
Augenblick, in welchem der Kolben 2/3 seines Weges zurückgelegt hat. Das Ein-
und Ausströmen des, in den betreffenden Cylindern befindlichen Dampfes wird dadurch
verhindert, daß die Expansionsfläche e vollständig von
der Ein- und Ausströmungskammer a und b getrennt ist, und ist der Dampf deßhalb gezwungen
durch Expansion fortzuarbeiten und den Kolben um das letzte Drittheil seines Weges
weiter zu treiben. Es ist einleuchtend, daß die Größe der Expansion ganz von der
Größe der Expansionsfläche abhängig ist, also der Maschine jeder beliebige
Expansionsgrad ohne jeden sonstigen Bewegungsmechanismus verliehen werden kann. In
unserem Falle findet die Expansion bei 2/3 des Hubes statt. Durch den Druck der
Scheibe R gegen den Körper S, und der Scheibe R
gegen das Lager der
einen Welle, würde eine bedeutende Reibung hervorgebracht werden, und wird deßhalb
dieselbe in den Gegenspitzen P und P' aufgefangen, und daher die Reibung auf ein Minimum
reducirt. Die Uebertragung der Arbeit einer Scheibe auf die andere erfolgt einfach
durch einen Mitnehmer m, der in den
Scheibenmittelpunkten angebracht ist. Die Riemenscheibe ist auf der Mitnehmerwelle
m aufgesetzt, und wird von da aus die Arbeit weiter
übertragen.
Da die Maschine, wie aus der Beschreibung hervorgeht, einen verhältnißmäßig kleinen
Raum einnimmt (eine 50pferdige Maschine würde beispielsweise eine Länge von 10 Fuß,
eine Breite von 5 Fuß und eine Höhe von 3 1/2 Fuß beanspruchen), bei verhältnißmäßig
kleinem Gewicht einen sehr gleichförmigen Gang hat und besonders auch bei ihrer
Einfachheit wenig Reparaturen erwarten läßt, so möchte sie sich für alle Zwecke, wo
Dampfkraft in mechanische Arbeit umgesetzt werden soll, gleich gut eignen.
Gegenwärtig ist Hr. Voß damit beschäftigt, seine
Erfindung im weitesten Sinne für stationäre Maschinen zur
Anwendung zu bringen, resp. die Ausführung solcher Maschinen in allen Staaten zu
bewerkstelligen.
2. Die Leistungsfähigkeit.
Es könnte auf den ersten Blick erscheinen, daß, veranlaßt durch die mehrseitige
Zerlegung der Kräfte, die Leistungsfähigkeit der Voß'schen Maschine sich nicht nach Art der gewöhnlichen Maschinen bemessen
ließe, bei welchen sich dieselbe durch den Druck auf den Kolben, multiplicirt mit
dem Weg desselben, ergibt; daß dem jedoch so ist, daß also die
Leistung des Dampfes im Cylinder vollständig auf die Scheiben (R und R') übertragen wird,
wollen wir hier zunächst durch Rechnung zeigen.
Es stellen AB und CD, Holzsch. 1, die horizontale Projection der beiden arbeitenden Scheiben
vor; die verlängerten horizontalen Durchmesser derselben schneiden sich in dem
Punkte w und bilden hier den Winkel α; die Linie wa
stehe normal auf AC, halbire also den Winkel α.
Für den Augenblick der Betrachtung befinde sich die Achse eines Kolbens in der Linie
bb', und bc =
K stelle den Druck auf die Kolbenfläche dar. Wird
dieser Druck zerlegt in einen solchen normal auf die Scheibe AB und in den horizontalen bf, so ist die Größe des letzteren:
K . sin.
α/2 (1)
Für die Umdrehung der Scheibe AB ist dieser Component in verschiedenen Lagen des Cylinders auch
verschieden wirksam; befindet er sich z.B. im horizontalen Durchmesser der Scheibe,
so wird seine Umdrehungskraft = 0; befindet er sich dagegen im verticalen Durchmesser
der Scheibe, so wird diese ihren vollen Werth K . sin. α/2 haben.
–
Textabbildung Bd. 172, S. 244
Um einen allgemeinen Ausdruck für die an der Scheibe AB wirkende Umdrehungskraft zu gewinnen, stelle
Holzsch. 2 die Stirnansicht der Scheibe AB vor,
und die Linie bf welche parallel der Linie AB, die oben erwähnte Componente K . sin. α/2. Bezeichnet ferner γ den Winkel, welchen der Radius bM mit der Linie AB bildet, und wird die
Zerlegung bf in angegebener Weise vorgenommen, so
ergibt sich die auf Umdrehung wirkende Componente bg:
K . sin.
α/2 . sin. γ (2)
Setzt man den Radius des Kolbens = r (in Zollen), den der
Scheibe AB = R, und
drückt man den Ueberdruck des Dampfes auf die Kolbenfläche per Quadratzoll durch p aus, so ist für den
gewählten Moment die
Umdrehungskraft auf die Scheibe AB:
πr²p . sin. α/2 . sin. γ (3)
Textabbildung Bd. 172, S. 245
Diese wird für das Wegelement R . dγ thätig seyn, und da die Kraft nur bei einer halben Umdrehung des
Cylinders thätig ist, so wird sich die Arbeit für diesen Weg ausdrücken durch:
Textabbildung Bd. 172, S. 245
oder, da das Integral
Textabbildung Bd. 172, S. 245
ist, durch:
2 . R . πr²p . sin. α/2 (5)
Für die zweite Scheibe CD hätte sich offenbar
derselbe Ausdruck ergeben, so daß, wenn die Scheiben t
Umdrehungen in der Secunde machen und n Cylinder vorhanden sind, die theoretische Leistung der
Maschine sich ausdrücken wird, durch:
4 . n . t
. R . πr²p sin. α/2 (6)
In Holzsch. 1 stellt offenbar die Summe der Linien mA und νC den Hub H der Kolben dar; es ist aber mA = νC =
2R sin. α/2 und
mA + νC daher = 4R . sin. α/2. Substituirt man diesen Werth
in die Gleichung (6), so
ergibt sich die theoretische Leistung der Maschine auch:
n . t . πr²p . H (7)
und dieß ist auch die theoretische Leistung von n Cylindern, resp. Kolben, welche t einfache Hübe in der Secunde machen und eine Hubhöhe H haben. Es findet sich demnach die theoretische
Leistung des Dampfes in den Scheiben der Voß'schen
Maschine vollständig wieder, was wir hier eben zeigen wollten. Selbstverständlich
würde sich dasselbe ergeben haben, wenn wir die ähnliche Betrachtung mit einer
Expansionsmaschine angestellt hätten.
In Formel (7) war H in Zollen zu denken; bezeichnen wir
jetzt noch die Hubhöhe der Kolben in Fußen mit H₁
und setzen t = u/60, wobei
u die Anzahl der Umdrehungen der Scheiben per Minute bezeichnet, so ergibt sich die theoretische
Leistungsformel der Voß'schen Dampfmaschine, in
Pferdestärken ausgedrückt, durch:
(n . u .
πr²p . H₁)/(60 . 480)
(8)
Zur Ermittelung der Reibungs- und sonstigen Widerstände bei der Voß'schen Dampfmaschine wurden in Gegenwart von mehreren
Technikern praktische Versuche mit einer solchen gemacht,
deren Resultate wir schließlich noch mittheilen wollen.
Die zu den Versuchen verwandte Maschine hatte 6 Cylinder, jeder einen Durchmesser von
6 Zoll und einen eben so großen Hub, wobei der Dampf bei 2/3 des Hubes abgesperrt
wurde. Der Winkel α, den die Scheiben bildeten,
betrug 18°, der Durchmesser, der auf dem Mitnehmer aufgekeilten Riemscheibe 3
Fuß, und die Entfernung der Kugelmitten des Mitnehmers 11 Zoll.
Um zur Bestimmung des theoretischen Effectes die Formel (8) benutzen zu können, wurde
mit jedem Bremsversuch ein Indicator-Versuch verbunden; als Mittel von den
gemachten 14 Versuchen ergab sich: daß einerseits der Gegendruck auf die Kolben,
außer dem Atmosphärendruck, 4 Pfund per Quadratzoll
betrug; anderseits die Leistung der Kolben bei der angewandten Expansion 1/6 kleiner
war, als sie sich bei Volldruck ergeben hätte. Diesem gemäß wurde zur Berechnung der
theoretischen Leistung der Maschine die Formel (8) mit 5/6 multiplicirt, und statt
p darin (p – 4)
gesetzt.
Das angewandte Brems-Dynamometer war in seinem Schwerpunkt abbalancirt, so daß
das Uebergewicht des Hebels nicht in Rechnung gebracht werden durfte. Die Berechnung
der wirklichen Leistung geschah nach der bekannten Formel:
(u . π . G)/(30 . 480) . l Pferdestärken,
und l wurde bei den Versuchen
constant = 5 1/2 Fuß erhalten.
Die Spannung des in die Maschine einströmenden Dampfes wurde ganz nahe der Maschine,
bei X
Fig. 1 Tab. V,
durch ein hier angebrachtes Manometer gemessen. Die betreffende Kesselanlage konnte
nur Dampf von circa 30 Pfund Spannung liefern, wogegen
die Maschine für 4 1/2 Atmosphären Ueberdruck berechnet war. Da bei der benutzten
Formel die Leistungen sich proportional den Spannungen ergeben, so konnten auch die
für 4 1/2 Atm. Spannung berechnet werden.
Die Anzahl der Umdrehungen, welche die Maschine bei jedem Versuch machte, wurden
mittelst eines Hubzählers gemessen, der da angebracht war, wo bei der beschriebenen
Maschine, Fig.
1 Tab. V, jetzt der Regulator angegeben ist. Die Zeitdauer jedes Versuchs
wurde mittelst einer guten Secundenuhr gemessen.
Die näheren Daten und Resultate der 14 gemachten Versuche gibt nun die nachfolgende
Tabelle.
Textabbildung Bd. 172, S. 247
Nummer des Versuchs; p.
Dampfspannung in Pfunden; u. Anzahl der Umgänge der Maschine per Minute; d.
Dauer des Versuchs in Minuten; G. Belastungsgewicht des Hebels; L₁
Nutzleistung der Maschine in Pferdestärken; M₁ Nutzleistung der Maschine
bei 4 1/2 Atm. Ueberdruck im Mittel von 14 Versuchen; L. Theoret. Leistung der
Maschine in Pferdestärken nach d. Formel 5/6 . (n . u . r²π (p
– 4) H₁)/(60 . 480); M. Theoretische Leistung in Pferdestärken
reducirt auf 4 1/2 Atmos. Spannung; L₁/L. Nutzeffect der Maschine in
Procenten; Arithmetisches Mittel von 14 Versuchen
Die Tabelle zeigt den mittleren Werth des Nutzeffectes zu 73 Proc.; da bei Maschinen
von gleicher Stärke und gewöhnlicher Construction der Nutzeffect sich
durchschnittlich nur 50 Procent ergibt, so dürfen wir die Voß'sche Maschine als sehr vollkommen in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit
bezeichnen. Veranlaßt ist dieß jedenfalls einerseits durch die zu Anfang unter 1)
und 2) erwähnte Eigenthümlichkeit der Construction dieser Maschine, andererseits
durch die geschickte Verhinderung von Reibungsarbeit an den
Wellenenden derselben.
Als sehr bemerkenswerthe Eigenschaft dieser Maschine bleibt noch zu erwähnen ihr gleichmäßiger Gang, der sie namentlich für manche
Arbeitsmaschinen empfehlenswerth macht. Selbstverständlich wird der große Nutzeffect
dieser Maschine eine Brennmaterialersparniß gegen andere Maschinen bedingen, wie
auch der Anschaffungspreis derselben, wegen ihrer Einfachheit, bedeutend niedriger
als der anderer Maschinen sich stellen wird.
Tafeln