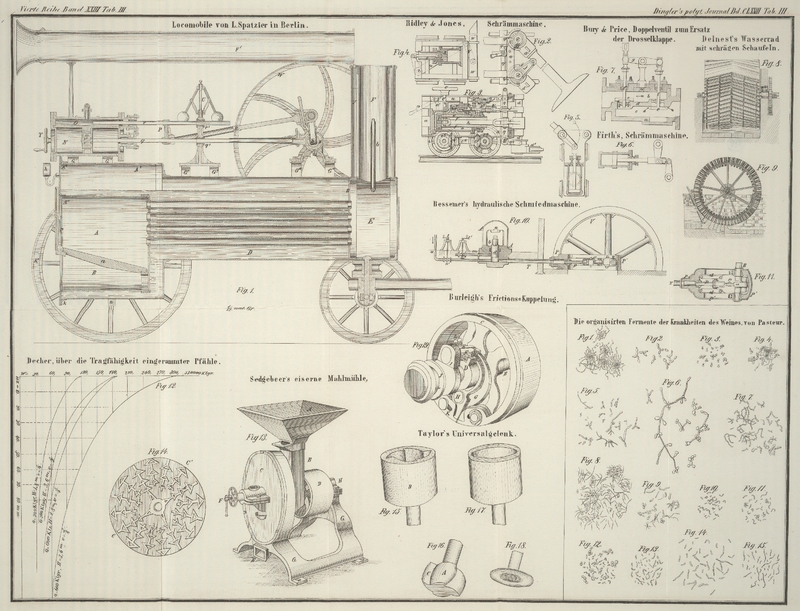| Titel: | C. Burleigh's Frictions-Kuppelung. |
| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. XLI., S. 185 |
| Download: | XML |
XLI.
C. Burleigh's
Frictions-Kuppelung.
Mit einer Abbildung auf Tab. III.
Burleigh's Frictions-Kuppelung.
Als eine einfache und geräuschlos arbeitende lösbare Kuppelung wird die von C. Burleigh in Fitchburg (Massach., Amerika) erfundene
gerühmt, von der wir in Fig. 19 eine Abbildung
nach dem Scientific American geben. Die Losscheibe A auf der Welle B ist auf
der innern Seite schwach zulaufend ausgebohrt und diese Ausbohrung dient zur
Aufnahme des geschlitzten Rades C. An der Nabe D des letzteren sitzen zwei kurze Backen E, deren einer abgebrochen gezeichnet ist; zwischen
diesen liegt der eckige Bolzen F, der mit seinem
abgerundeten Ende gegen den gekrümmten, um H drehbaren
Hebel G trifft. Der andere Arm dieses Hebels trifft
gegen den geschlitzten Theil des Rades C, der Bolzen F endlich ist mit dem Muffe I fest verbunden, der auf der Welle verschiebbar ist. Wird also durch das
Eingreifen der Rückgabel in den Hals J des Muffes I der letztere auf der Welle vorgeschoben, so drückt der
Bolzen F gegen den Hebel G
und dessen zweiter Arm bei K gegen das geschlitzte
Frictionsrad C; dadurch wird das letztere fest an die
innere Seite des
Hauptrades gedrückt und die Umdrehung der Welle B
bewirkt. Das Rad C ist durch zwei starke Stellschrauben
L mit der Welle verbunden. ( Deutsche
Industriezeitung, 1864, Nr. 17.)
Tafeln