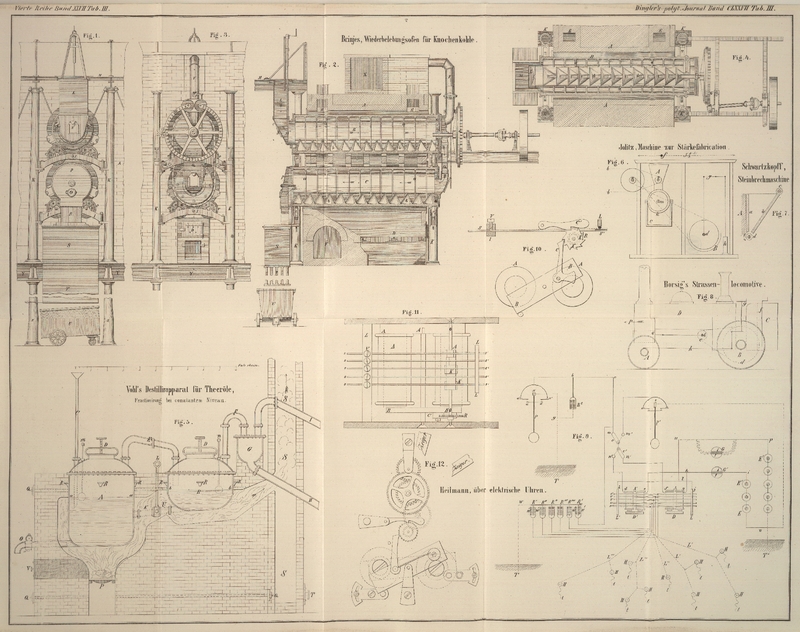| Titel: | Einige Notizen von der Stettiner Maschinen-Ausstellung; von Dr. Rob. Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |
| Autor: | Robert Schmidt |
| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. XX., S. 116 |
| Download: | XML |
XX.
Einige Notizen von der Stettiner
Maschinen-Ausstellung; von Dr. Rob. Schmidt,
Civilingenieur in Berlin.
(Schluß von S. 19 des vorhergehenden
Heftes.)
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Schmidt, über einige Maschinen der Stettiner
Ausstellung.
Von Arbeitsmaschinen haben wir als eigenthümlich zu
erwähnen:
die Maschine zur Stärkefabrication von
W. Jolitz in Frankfurt a. O.
Dieselbe enthält, ähnlich wie die von uns früher in diesem Journal (Bd. CLXIX S. 257)
beschriebene Eckert'sche Maschine, im Zusammenhange alle
Vorrichtungen, um aus Kartoffeln Stärke zu fabriciren und ist dabei transportabel.
Fig. 6
läßt die Lage der Hauptwellen in einer Seitenansicht erkennen.
a ist die Betriebswelle, welche zwei große und zwei
kleinere Riemscheiben enthält. Mittelst einer dieser Scheiben wird durch b die Maschine von einer Locomobile getrieben, während
die zweite (große) Scheibe die Welle c der Reibe A treibt. Die vorn auf der Welle a gelegene kleine Riemscheibe treibt die Welle d. Ein längeres Stück derselben ist mit eisernen Schlägern versehen,
welche in einem halbcylindrischen Troge B sich bewegen,
in welchen, behufs des Waschens, die zu verarbeitenden Kartoffeln gebracht werden. Der
letzte dieser Schläger hat an seinem Ende die Form, daß er die gewaschenen
Kartoffeln in einen Trog wirft, aus welchem ein Elevator dieselben nach der Reibe
A führt. Die Betriebsscheibe dieses Elevators
befindet sich ebenfalls auf der Welle d, während die
zweite Welle f desselben sich über der Reibe befindet.
Das hinten gelegene Ende der Welle d ist mit Krummzapfen
versehen, und treibt mit diesem und dem Hebel g die
Pumpe h. Das Steigrohr derselben führt nach einem
Reservoir, aus welchem das Wasser sowohl nach der Reibe als nach dem
Kartoffelwaschtrog gelassen werden kann. m ist die Welle
der Siebtrommel, welche von einer auf dem hinteren Ende der Welle a befindlichen kleinen Riemscheibe getrieben wird. Der
Mantel der cylindrischen Siebtrommel ist mit Bürsten versehen, welche sich
spiralförmig um denselben winden, und in passender Entfernung mit einem Mantel n aus Messinggaze umgeben. Die geriebenen Kartoffeln
treten am hinteren Ende dieses Mantels ein, und werden von dem Bürstencylinder mehr
und mehr nach vorn bewegt, wobei die Stärke in den Kasten C fällt, während die Schlempe vorn durch eine Oeffnung aus der Maschine
tritt.
Die ganze Maschine hat etwa eine Breite von 5 1/2 Fuß, ebensoviel Höhe und eine Länge
von beiläufig 7 Fuß. Die Fabrik hat derartige Maschinen bereits in großer Zahl
gebaut und liefert eine solche für den Preis von 460 Rthlrn. Das tägliche
Arbeitsquantum beträgt 8 Mispel Kartoffeln.
Die Steinbrechmaschine von L.
Schwartzkopff in Berlin.
Dieselbe dient dazu, um Feldsteine derartig zu zerkleinern, daß sie zum Chausseebau
verwandt werden können. Wir theilen nur das zu Grunde liegende Princip derselben
mit: In einem starken gußeisernen Kasten A, Fig. 7, ist
eine senkrechtstehende Platte a befestigt, welche auf
der zu Tage tretenden Seite im Querschnitt wellenförmig gestaltet ist. Eine zweite
Platte b, auf der Seite b
ebenfalls wellenförmig im Querschnitt, ist um eine starke Achse c drehbar und bildet mit der Platte a immer einen spitzen Winkel. Die zu zerkleinernden
Steine werden in den Raum B zwischen die Platten a und b geworfen, und
dadurch zerkleinert, daß die Platte b hin- und
herschwingt. Dazu wird letztere an ihrem unteren Ende von einem, um eine horizontale
Achse schwingenden Maschinentheil ergriffen, der mittelst Excentric von der
Hauptwelle aus bewegt wird. Diese Hauptwelle bewegt mittelst Riemen noch eine kleine
Welle d, welche sich unterhalb der Platten a und b befindet und
cannelirt ist; dieselbe hat den Zweck: einerseits durch ihre Bewegungsrichtung die
Steine aus der Maschine zu werfen, anderseits Steine von verschiedener Größe herstellen
zu können; zu letzterem Ende können die Lager dieser Welle den Platten a und b mehr oder weniger
genähert werden. Diese Maschine wurde auf der Stettiner Industrie-Ausstellung
in Gemeinschaft mit einer Schwartzkoppf'schen
Frictionsramme von einer Locomobile aus derselben Fabrik getrieben, und zeichnete
sich sowohl durch ihre Productivität als ihre solide Bauart vortheilhaft aus.
––––––––––
Im Anschluß an diesen Artikel, besonders an die darin gegebenen Notizen über die Schwartzkopff'sche Straßenlocomotive, wollen wir noch
einige Bemerkungen über eine Straßenlocomotive folgen lassen, welche unlängst in der
Borsig'schen Fabrik in zwei Exemplaren ausgeführt
wurde.
Fig. 8 gibt
eine Skizze dieser Maschine; der Pfeil P bezeichnet den
gewöhnlichen Vorwärtsgang derselben. Die Räder A und B der Maschine sind wie bei der Schwartzkopff'schen aus schmiedeeisernen Scheiben gebildet. Der Tender C und die eigentliche Maschine D sind auch hier fest mit einander verbunden. Doch nimmt ersterer, sowohl
in seinem unteren Theil das Wasser, als auch in seinem oberen Theil die Kohlen auf.
Die zwei Cylinder a befinden sich unter der Rauchkammer,
und treiben durch ganz ähnliche Anordnungen wie bei Locomotiven die Hauptachse b. An dem einen, hier hinteren, Ende dieser Welle
befindet sich ein Kettenrad c, von welchem aus, durch
nur eine Kette, die Treibräder getrieben werden. Der
punktirte Kreis d deutet das zweite, mit dem hinteren
Treibrade gekuppelte Kettenrad an. Mit dem vorderen Treibrade ist, symmetrisch mit
dem Kettenrade d, eine Scheibe d verbunden, welche zum Bremsen der Maschine dient, und wird das Bremsband
durch die Kurbel f dirigirt. Die, ganz ähnlich wie bei
Locomotiven angeordnete Steuerung der Maschine ist rechts vom Führerstande aus zu
dirigiren, wogegen die schon erwähnte Kurbel f und das
Directionsrad g für die Lenkvorrichtung sich zur Linken
des Führers befinden. Das Rad g ist mit einer
Schraubenspindel verbunden, die mit einer Hebelcombination in Verbindung gebracht
ist, an welche die Zug- und Schubstange h
angeschlossen ist; durch letztere kann also von g aus
die Lenkachse nach zwei Richtungen hin gedreht, und somit die Maschine gelenkt
werden. – Die mit den Maschinen, in den dazu sehr ungünstigen Räumen der Borsig'schen Fabrik angestellten Fahrversuche haben sehr
günstige Resultate geliefert.
Tafeln