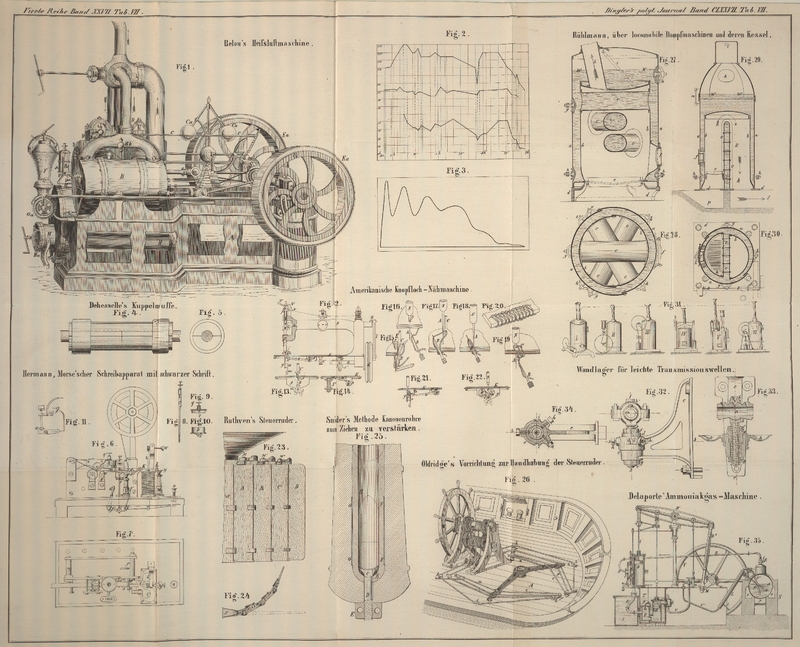| Titel: | Der Kuppelmuff von Dehessele. |
| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. CIX., S. 458 |
| Download: | XML |
CIX.
Der Kuppelmuff von Dehessele.
Aus der Zeitschrift des Vereines deutscher
Ingenieure, 1865, Bd. IX S. 299.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Dehessele's Kuppelmuff.
Im Bulletin de la Société industrielle de
Verviers wird von L. Bède über einen von
Dehessele construirten Kuppelmuff berichtet, welcher
im Nachstehenden beschrieben und in Fig. 4 und 5 abgebildet ist. Das
Eigenthümliche dieser Kuppelung ist, daß weder Keile noch Bolzen zu derselben
nothwendig sind, sondern die zu verbindenden Wellen werden nur durch den Druck,
welchen zwei schmiedeeiserne Ringe auf einen aus zwei Hälften bestehenden, nach
einem schwachen Doppelkegel geformten Muff ausüben, zusammen gehalten. Die Kegelform
tritt sehr wenig hervor, da der Muff in der Mitte nur um 2 bis 3 Millimeter stärker
ist als an den Enden. Auf diesen runden Doppelkeil drücken sehr kräftig die beiden
Ringe, welche mit Hammerschlägen aufgetrieben werden. Die Praxis hat bereits
bewiesen, daß derartige Muffe, selbst wenn die Wellen eine sehr große Kraft zu
übertragen haben, sich vollständig bewähren, wenn sie nur sorgfältig dem
Wellendurchmesser entsprechend ausgebohrt sind. Damit der Muff nicht auf der Welle
gleitet, braucht nur die von der Welle zu übertragende Arbeit geringer zu seyn als
die zur Ueberwindung der durch den Druck der Ringe hervorgebrachten Reibung nöthige.
Ist p der auf die Ringe ausgeübte Druck, und 0,19 der
Reibungscoefficient für Schmiedeeisen auf nicht geschmiertem Schmiedeeisen, so ist
diese Reibung R = 0,19p. Der
Druck p kann eine gewisse Grenze nicht überschreiten,
welche von der Bruchfestigkeit der Ringe abhängt, und zwar darf höchstens p = 2rel seyn, wenn
e die Dicke der Ringe, l
ihre Breite (in Centimetern) und r die Zahl von
Kilogrammen ausdrückt, welche beim Zerreißen einer Eisenstange von 1
Quadratcentimeter Querschnitt nöthig ist. Es ist sonach die Reibung
R = 0,19 p = 0,19 . 2 rel,
und die Arbeit, welche dieselbe für eine Umdrehung der Welle
beansprucht, ist, wenn letztere den Umfang c (in Metern)
besitzt:
A = 0,19 . 2 rel . c,
oder bei n Umdrehungen per Minute, die Arbeit per
Minute
0,19 . 2 ncrel.
Die Arbeit, welche eine Welle von: Durchmesser d bei n Umdrehungen per Minute übertragen kann, ist, wenn d sowie der Umfang c in
Metern gegeben sind, = 262,000 d². 2nc.Dieser Werth entspricht ziemlich genau der zur Berechnung schmiedeeiserner Wellen tauglichen Formel d = 90 ∛(N/n) worin d den
Durchmesser der Welle in Millimetern, N die
Anzahl der übertragenen Pferdestärken, n die
Anzahl der Umdrehungen per Minute bezeichnet,
und worin ferner die höchst zulässige Spannung des Materiales zu 4,8 Kil.
per Quadratmillimeter angenommen ist. L. Es muß also
0,19 . 2ncrel ≧ 262,000 d² . 2nc
seyn, oder
rel ≧ 1,379,000 d².
Da der Muff keinen Stößen ausgesetzt ist, kann man r =
1000 Kilogr. setzenHieraus geht wohl hervor, daß unter r nicht, wie
oben angegeben, die Zahl von Kilogrammen ausgedrückt wird, welche zum
„Zerreißen“ einer schmiedeeisernen Stange von 1
Quadratcentimeter Querschnitt nöthig ist; sondern es bedeutet vielmehr r = 1000 Kil. die für Schmiedeeisen per Quadratcentimeter Querschnitt bei der
Inanspruchnahme auf absolute Festigkeit zulässige
Spannung, was auch hier passend erscheint, indem ein Werth von 1500 Kil. der
Elasticitätsgrenze entsprechen würde. L., wornach
el ≧ 1379 d², oder, wenn 1/100 = 5/4 d gesetzt wird,
e = 11,03 d, oder
e = 0,11 d, wenn d wie e in Centimetern
gegeben sind.
Da aber die Wellen nach den gewöhnlichen Formeln eine große Sicherheit erhalten und
daher sehr wohl eine doppelte Leistung, als die gewöhnliche, übertragen können und
auch öfters müssen, so setzt man besser
e = 0,25 d.
Die Dicke der Ringe ist also gleich 1/4 des Durchmessers der zu kuppelnden Welle und
ihre Länge gleich 5/4 desselben zu machen. Der gußeiserne Muff, welcher durch diese
Ringe festgedrückt wird, muß wenigstens eine ebenso große Torsionsfestigkeit
besitzen wie die Wellen. Ist daher D der äußere
Muffdurchmesser, so braucht, wenn man die Torsionsfestigkeit des Gußeisens gleich
1/3 von der des Schmiedeeisens setzt, nur
(D⁴ – d⁴)/D = 3 d³ oder (D/d)⁴ = 3 D/d + 1
zu seyn. Dieser Gleichung entspricht der Werth D/d = 1,54; man hat also mit
aller Sicherheit D/d = 2,
d.h. man hat den äußeren Muffdurchmesser doppelt so groß zu machen wie den der
Welle. Die Länge des Muffes ist beliebig, muh aber natürlich wenigstens der
Gesammtlänge beider Ringe gleich, also 5/2 d seyn, wozu
noch ein hinreichender Zwischenraum zwischen beiden Ringen kommen muß, damit man
sie, wenn nöthig, herunter schlagen kann. Man erhält sehr gute Verhältnisse, wenn
man diese Länge 5mal so groß macht, wie den Wellendurchmesser. Das Gewicht eines so
construirten Muffes beträgt 0,119 d³ Kilogr.,
wenn d in Centimetern ausgedrückt ist. Für Wellen von
mehr als 10 Centimet. Durchmesser kann man die Länge etwas vermindern, um das
Gewicht herabzuziehen.
Die Vortheile dieser Kuppelungsweise sind leicht einzusehen. Da der Muff und die
Wellen vollständig auf der Drehbank fertig gemacht werden, so können sich bei der
Verbindung keine solchen Abweichungen einstellen, wie sie bei schlecht eingepaßten
Keilen öfters vorkommen; die Wellen selbst bleiben unversehrt und also stärker, als
wenn sie an den Enden behufs der Verbindung besondere Bearbeitungen erleiden müssen.
Das Auf- und Abbringen des Muffes und der Ringe ist sehr leicht, und die
Kuppelungen dieser Art haben nie etwas zu wünschen übrig gelassen, sobald nur die
Ringe richtig aufgetrieben und die Wellenenden genau von gleichem Durchmesser waren.
Wenn sich bei letzteren eine geringe Abweichung zeigt, so kann man sich durch
Auflegen eines passenden Weißbleches helfen; auch kann man, wenn solche
Schwierigkeiten eintreten, die Verbindung des Muffes mit der Welle dadurch inniger
machen, daß man letztere mit einer Flüssigkeit, z.B. etwas Essig, benetzt, welche
die Oxydation befördert. Die nöthige Kraft zum Auftreiben der Ringe ist nicht
bedeutend; denn nimmt man das Verhältniß zwischen der Differenz der Durchmesser an
der Muffmitte und den Muffenden zur halben Mufflänge = 1/50, so ist der Druck, den
die Ringe auszuüben haben, nach dem Vorhergehenden: p =
2 rel = 2 . 1000 . d/4 . 5/4
d = 625 d², die
Kraft zum Auftreiben aber = p/50 = 12,5 d², wobei d wieder in
Centimetern zu geben ist.Diese Berechnung der Kraft zum Auftreiben der Ringe würde nur unter der
Voraussetzung nahezu richtig seyn, daß während des Auftreibens eine Drehung
der Ringe auf dem Muffe veranlaßt wird. Anderenfalls wird auf Ueberwindung
der Reibung ein so großer Theil der auftreibenden Kraft verwendet, daß diese
letztere circa 20 Mal größer als die hier
angegebene ist. R. W.
Diese Kuppelungsweise läßt sich auch sehr gut für das Festkeilen von Riemenscheiben,
Schwungrädern und selbst von Zahnrädern verwenden; man braucht dazu nur die Nabe
derselben nach einem sehr spitzen abgestumpften Kegel auszubohren, in welchen eine
äußerlich nach derselben Form abgedrehte und im Innern dem Wellendurchmesser
entsprechend ausgebohrte Hülse genau paßt; diese Hülse schneidet man dann der Länge
nach entzwei und erhält so einen conischen Doppelkeil. Diese Methode wird in Ronen
und auch in Verviers sehr häufig angewendet. (Mit Benutzung der deutschen
Industriezeitung, 1864, Nr. 47.)
R. W.
Tafeln