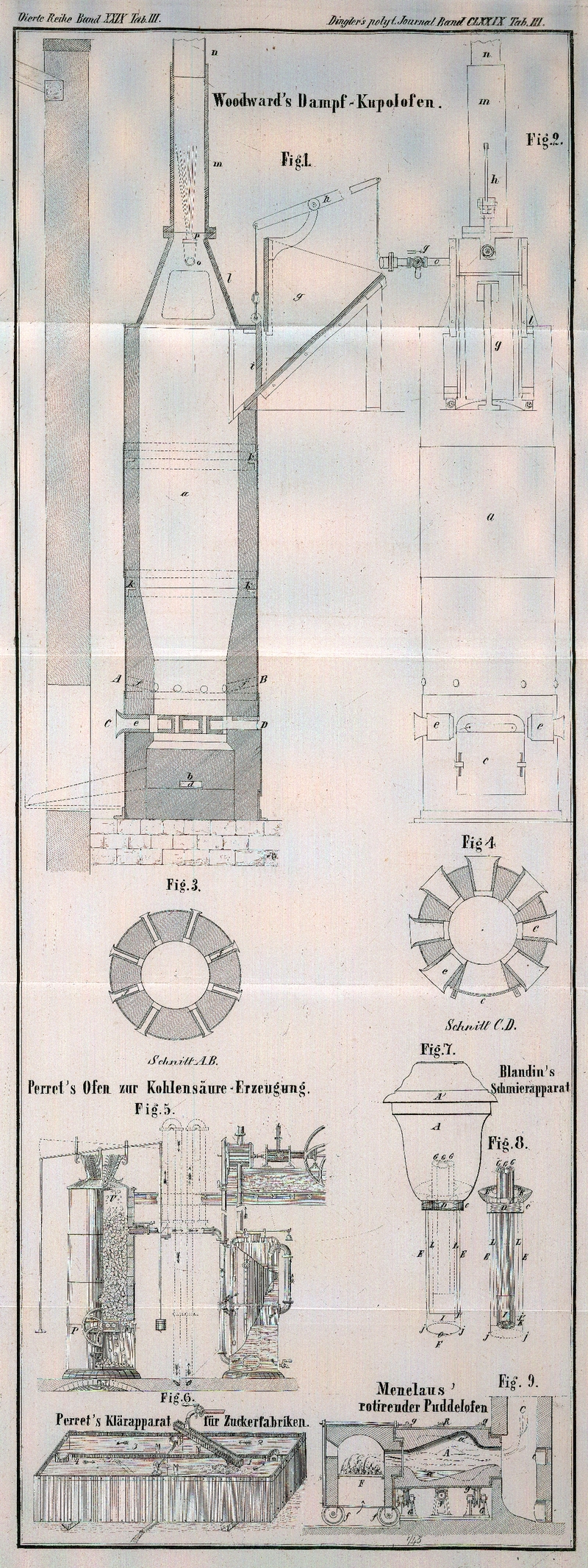| Titel: | Apparat zur continuirlichen Kohlensäureerzeugung, und Klärapparat oder Absetzgefäß für Zuckerfabriken; von A. Perret in Roye (Somme). |
| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. XL., S. 148 |
| Download: | XML |
XL.
Apparat zur continuirlichen Kohlensäureerzeugung,
und Klärapparat oder Absetzgefäß für Zuckerfabriken; von A. Perret in Roye
(Somme).
Aus Armengaud's Génie industriel, November 1865, S.
233.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Perret's Apparat zur continuirlichen
Kohlensäureerzeugung.
Diese beiden Apparate sind aus den Bedürfnissen hervorgegangen, welche die neueren
Verfahrungsweisen der Zuckerfabrication (verstärkter Kalkzusatz und vermehrte
Saturation) geschaffen haben.
Der Kohlensäureofen ist in Fig. 5 dargestellt. Er
besteht zunächst aus einem cylindrischen Ofen von mit feuerfesten Steinen
ausgefüttertem Eisenblech. Oben befindet sich ein conischer Fülltrichter mit dem
Verschluß V von gleicher aber umgekehrter Gestalt wie
der Trichter. Dieser Verschluß wird durch einen Hebel mit Stange und Handgriff durch
den Arbeiter regiert. Der Rost ist mit Zahnrädern und einem Griffrad P versehen, so daß er leicht umgekehrt werden kann.
Zu dem Ofen gehört ferner ein Wascher in Form eines Cylinders, welcher in zwei durch
eine Röhre verbundene, über einander liegende Theile getheilt ist, sowie eine
Dampfpumpe. Diese saugt durch ein nach den Localverhältnissen verschieden
einzurichtendes Röhrensystem die Gase aus dem Ofen und durch den Wascher, und drückt
sie in den zu saturirenden Saft.
Der Ofen wird folgendermaßen in Gang gesetzt: Man legt auf den Rost eine 10 Centimet.
dicke Schicht Stroh, bringt dann von oben etwa 50 Centimet. hoch Stückkreide ohne
Kohks, und endlich etwa 1 Hektoliter glühender Holzkohlen ein. Hierauf beschickt man den Ofen
einen Meter hoch mit dem „Normalgemenge“ (s.u.) und setzt nun
die Maschine in Gang. Der in Brand gerathene Ofen wird dann weiterhin stets bis zu
der in der Figur angegebenen Höhe gefüllt erhalten, während man unten von Zeit zu
Zeit den Inhalt durch Drehen des Griffes P entfernt. Der
einmal angezündete Ofen braucht während der ganzen Campagne nicht auszulöschen.
Das Laden und Entladen hat so zu geschehen, daß die größte Hitze ziemlich constant
auf 1 3/4 Meter oberhalb des Rostes erhalten wird und der Rost selbst nicht zum
Glühen gelangt. Natürlich hängt der Gang des Ladens und Entladens von dem Gang der
Pumpe ab, und man hat durch Regulirung des letzteren und durch Vermehrung der
Kohksmenge im Gemische die Erzeugung beliebiger Mengen Kohlensäure in der Hand.
Der in der Figur dargestellte Ofen hat 1,30 Meter im Durchmesser und kann in 24
Stunden 700 bis 1000 Hektoliter Saft (selbst bei doppelter Carbonatation) mit
Kohlensäure versehen; bei noch größerem Bedarf muß man einen größeren Ofen oder auch
zwei Oefen aufstellen.
Zum Beschicken des Ofens dient Kalkstein in solchen
Stücken, daß sie durch ein Sieb mit langen Maschen von 6–7 Centimeter Breite
durchgehen; wollte man dickere Stücke anwenden, so müssen sie wenigstens alle
gleichgroß seyn. Ueberhaupt kommt es auf die Dicke der Kalkstein-Stücke nicht
so genau an, da man sie in der Praxis doch bloß durch Zerklopfen herstellt.
Die Kohksstücke sollen von Nußgröße seyn, doch kann auch aller Abfall benutzt werden.
Kalkstein und Kohks müssen trocken und gut gemengt seyn.
Unter „Normalgemenge“ ist ein solches von 1 Hektoliter Kohks und
2 bis 3 Hektoliter Kalksteinstücken zu verstehen. Man füllt stets den Trichter
vorher voll, damit der Inhalt gut trocken wird, ehe er in den Ofen gelangt.
Dieser Ofen gewährt folgende Vortheile: Die Ladung kann sich nicht festsetzen,
sondern sinkt in gleichmäßigen horizontalen Schichten nieder, so daß die Kohks
vollständig ausgenutzt werden und aller Kalk richtig gebrannt wird.
Der Ofen braucht im Eisen nur wenige Millimeter stark zu seyn und eine schwache
Steinverkleidung zu haben; man kann ihn im Freien oder auch in der Fabrik
aufstellen, und im letzteren Falle auch zum Heizen benutzen. Er ist viel wohlfeiler
als alle gemauerten Oefen und für Zuckerfabriken jeder Ausdehnung zu benutzen.
Das Gas ist reichlich und sehr rein, auch von hohem Gehalte und frei von Kohlenoxyd. Man braucht
nur 1/4 so viel Kohks wie bei bloßen Kohksöfen und erspart also viel Brennmaterial
bei größerer Reinheit des Productes. Der als Nebenproduct fallende gebrannte Kalk
kann zur Scheidung oder auch als Dünger benutzt werden.
Der Klär- oder Absetz-Apparat, welcher in Fig. 6 dargestellt ist,
zeichnet sich durch große Einfachheit, gute Wirksamkeit und allgemeine Anwendbarkeit
aus, da er überall zu brauchen ist, wo man Flüssigkeiten von den darin suspendirten
Körpern befreien will.
Dieser Apparat besteht aus einem in vier Abtheilungen getheilten eisernen
rechteckigen Kasten. In der oberen Ecke jeder Abtheilung ist eine Erweiterung
angebracht, welche einen Ueberlauf bildet und wodurch je zwei Abtheilungen mit einer
irgendwie zu verschließenden weiten runden Oeffnung verbunden sind. In der Mitte des
Kastens, und zwar an dessen Boden, nahe der Ecke jeder Abtheilung, befindet sich ein
Hahn, dessen hohler Hintertheil bis zum oberen Rande des Kastens emporsteigt und
nach Belieben bis auf den Boden umgelegt werden kann.
Unterhalb des Kastens befindet sich ein zweiter kleinerer, in welchen sämmtliche 4
Hähne einmünden und von wo aus die Flüssigkeit nach ihrem Bestimmungsort weiter
geführt wird.
Die zu klärende Flüssigkeit tritt durch eine kleine Rinne in eine der vier
Abtheilungen, z.B. in Nr. 1, deren linke Abzugsöffnung geschlossen, und deren Hahn
emporgehoben ist. Erst wenn die Abtheilung voll ist, fließt die geklärte Flüssigkeit
durch den rechts gelegenen Ueberlauf in die Abtheilung 2 ab, von wo sie ebenso nach
3 und endlich nach 4 gelangt. Die Verbindung von dieser nach 1 ist jedoch gesperrt,
dagegen der Hahn schwach geneigt, so daß durch denselben die Flüssigkeit nach dem
unteren Kasten abfließen kann. In dieser Weise geht der langsame und durch keinen
Stoß gestörte Strom fort, so daß sich in allen Abtheilungen an Stärke abnehmende
Bodensätze bilden, bis Nr. 1 damit angefüllt ist. Nun wird diese Abtheilung
abgestellt und der Zufluß auf Nr. 2 gerichtet. Nach kurzer Ruhe neigt man den Hahn
in Nr. 1 nach und nach, um möglichst viel klare Flüssigkeit abzuziehen, worauf der
Hahn wieder gehoben und der Bodensatz durch eine besondere Oeffnung entleert und
seiner Bestimmung zugeführt wird. Die ausgewaschene Abtheilung l wird dann wieder in den Kreislauf aufgenommen, worin
sie nun die letzte wird, hierauf zunächst 2 gereinigt u.s.w.
Man sieht, daß der Zulauf nicht unterbrochen zu werden braucht und das Ganze in
regelmäßigem Gange bleibt und eine continuirliche Klärung bewirkt, welche alle
folgenden Arbeiten sehr erheblich vereinfachen muß. So wird auch das Filtrationsgeschäft wesentlich
verbessert, weil klare Säfte stets besser filtriren als trübe u.s.w.
Die Vorzüge dieses Klärapparates dürften hiernach in die Augen fallend seyn. Die
Verbindung mit dem Kohlensäureapparat wird verschiedene Arbeitsweisen möglich machen
und dabei Kostenersparniß bewirken.
Tafeln