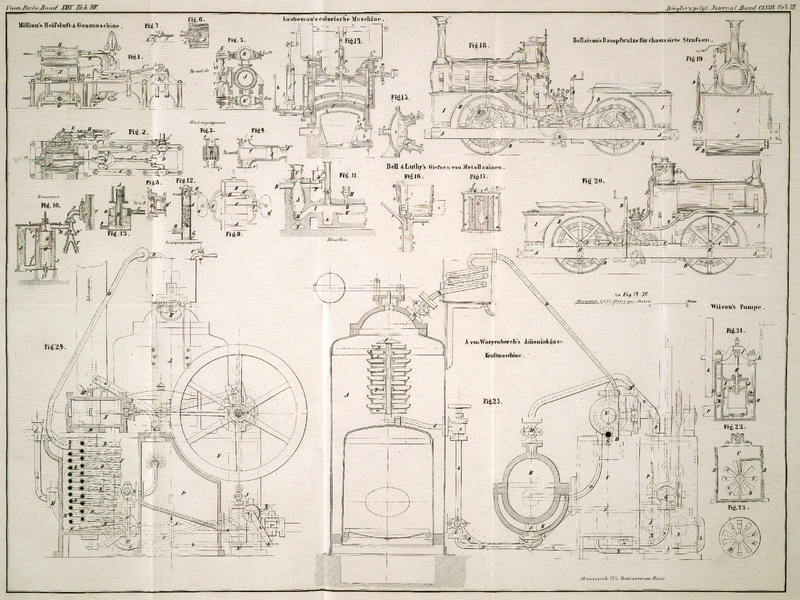| Titel: | J. C. Wilson's Pumpe. |
| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. LXXXIII., S. 355 |
| Download: | XML |
LXXXIII.
J. C. Wilson's Pumpe.
Aus dem London Journal of arts Januar 1866, S.
8.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Wilson's Pumpe.
Bei der Pumpenconstruction, welche sich J. C. Wilson in
London am 27. September 1864 patentiren
ließ, wird der Ein- und Austritt der zu pumpenden Flüssigkeit ohne Anwendung
von Ventilen regulirt, nämlich bloß mittelst des im Apparate vorhandenen leeren
Raumes oder Druckes.
Fig. 21
stellt einen verticalen Durchschnitt dieser Pumpe dar. A
ist der Cylinder oder das arbeitende Rohr, welches mit Zapfen a, a versehen ist, um die es ungehindert schwingen kann. Die Zapfen drehen
sich in Lagern b, b, welche an der Innenseite des
Behälters oder der Cisterne B angebracht sind. Dieser
Behälter ist auf der einen Seite in eine Saugkammer C
und eine Ausflußkammer D abgetheilt, und die Seite der
Kammer nächst dem Rohr A ist mit Löchern c, c versehen, wie der Querschnitt Fig. 22 zeigt. Fig. 23 ist
eine Ansicht, welche die Oeffnungen d, d in der Wand des
Cylinders A zeigt. E ist ein
Saugrohr, F ein Abflußrohr; G ist der im Cylinder sich bewegende Kolben, welcher durch seine Stange
H mit der Kurbel I
verbunden ist. K ist ein Schwungrad und L ist ein Drehling, um die Pumpe von Hand in Thätigkeit
zu setzen. M ist eine Schraube, um die sich bewegende
Seite des Cylinders mit der Seite der Kammern C, C in
Berührung zu erhalten. Wenn man die Pumpe in Gang setzt und der Kolben G sich zum Beispiel von oben nach unten im Cylinder A zu bewegen beginnt, werden die Saugöffnungen in der
Cylinderwand, welche mit dem Kopfe des Cylinders communiciren, den Oeffnungen in der
Saugkammer C gegenüber gebracht und es dringt Wasser
oben in den Cylinder über den Kolben ein; gleichzeitig veranlaßt das Schwingen des
Cylinders das Schließen der Saugöffnungen welche mit dem Boden des Cylinders
communiciren, sowie das Oeffnen der Ausflußöffnungen, und der Kolben treibt bei
seinem Niedergange das Wasser in die Abflußkammer D. Die
entgegengesetzte Wirkung findet beim Aufgange des Kolbens im Cylinder (von unten
nach oben) statt.
Die Pumpe kann auch, statt von Hand, durch Dampfkraft betrieben werden, zu welchem
Zwecke dann eine Riemscheibe, oder ein gezahntes Rad etc. an die Kurbelwelle
befestigt wird.
Tafeln