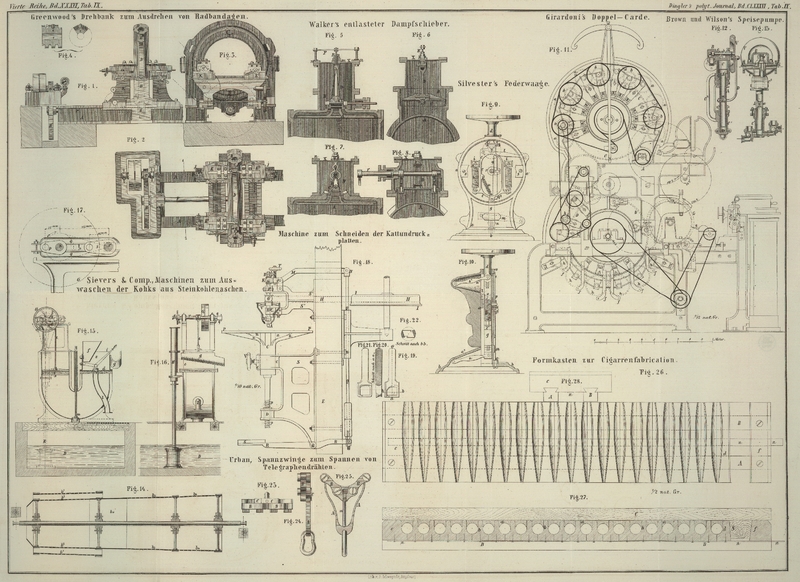| Titel: | Die Gewinnung der Kohks aus Steinkohlenaschen; von H. Ludewig. |
| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. XCIX., S. 442 |
| Download: | XML |
XCIX.
Die Gewinnung der Kohks aus Steinkohlenaschen;
von H. Ludewig.
Aus der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure,
1867, Bd. XI S. 519.
Mit Abbildungen auf Tab.
IX.
Ludewig, über Gewinnung der Kohks aus
Steinkohlenaschen.
Die Verbesserungen, welche seit Jahren bei den Feuerungen angestrebt wurden, zielten
zumeist auf Erreichung einer vollkommeneren Verbrennung der Brennmaterialien durch
veränderte Rosteinrichtung, entsprechende Luftzuführung etc., indem man die
sogenannte Rauchverbrennung herbeizuführen suchte, und hatten in ökonomischer
Beziehung nur verhältnißmäßig geringe Resultate; dagegen ist ihr Welch, wenn die
Verbrennung des gebildeten Rauches erreicht wird, in gesundheitspolizeilicher
Beziehung bedeutend genug.
Der größere Verlust an Nutzeffect bei den Feuerungen mit festem Brennmaterial liegt
aber wohl darin, daß in den Aschenrückständen die nicht vollständig verbrannten
Brennmaterialstücke, also bei Steinkohlenfeuerung Kohksstücke, und die beim Schüren
durch den Rost gefallenen Cinders enthalten sind und somit werthlos werden. Denn
selten wohl ist es bei technischen Processen bisher ohne Weiteres möglich, solche
Aschen, wenigstens auf den in ihnen noch enthaltenen Brennwerth auszunutzen, und zumeist bildet die
Forträumung der Löschen, welche bei ihrer Ansammlung einen großen Raum einnehmen,
eine unangenehme, mit Kosten verbundene Aufgabe. Die Verwendung, welche die
Steinkohlenaschen wegen der in ihnen enthaltenen Schlacken wohl als Material zum
Chausseebau, überhaupt als Füllmaterial, als Zusatz zum Mörtel etc. finden, möchte
gewiß nur als sehr untergeordnet zu bezeichnen seyn.
Es müssen deßhalb Vorrichtungen, welche es gestatten, mit geringen Kosten die in den
Steinkohlenaschen enthaltenen, noch verwerthbaren Brennmaterialreste von den
begleitenden unverbrennlichen Stoffen, den Schlacken, vollständig zu trennen und so
wieder ein zwar verkohltes, aber gewiß vollkommen brauchbares und concentrirtes
Brennmaterial herzustellen, da überall von großem Nutzen seyn, wo, wie zumeist, die
Kosten der Steinkohlenfeuerung bedeutend sind.
Außer dem Vortheile, die Brennmaterialreste auf solche Weise wieder nützlich
verwenden zu können, hätte man hierbei den auch wohl in Anschlag zu bringenden der
wesentlichen Verminderung der fortzuräumenden Aschenmengen, welche dann nur eben aus
den Schlackenbeständen gebildet würden.
Vorrichtungen, welche diese angegebenen Vortheile erreichbar machen, sind seit
mehreren Jahren von der namentlich im Bergwerksmaschinenbaufach renommirten
Maschinenfabrik von Sievers u. Comp. in Kalk bei Deutz am Rhein mit großem Erfolge gebaut worden und
vielfach in Gebrauch gekommen.
Die Verarbeitung der Aschen geschieht in ganz ähnlicher Weise wie die bekannte
mechanische Aufbereitung der Erze und namentlich der Steinkohlen: Die Aschen werden
nach verschiedener Korngröße gesiebt und hierauf in einer Setzmaschine die
Kohksstücke heraus gewaschen. Die herbei gefahrene Asche wird durch eine
Schüttöffnung in ein Cylindersieb B
Fig. 14
eingebracht und hier in fünf verschiedene Korngrößen getrennt, welche in darunter
befindliche Abtheilungen fallen, die den Trommeltheilen b¹, b¹ bis b⁴ b⁴
entsprechen. Statt des Einfülltrichters ist bei größeren Ausführungen die
Einrichtung auch so getroffen, daß durch eine auf der Verlängerung der Trommelwelle
befestigte Schnecke aus einem vor der Trommel angebrachten Kasten die hier
aufgegebene Asche gleichmäßig in das Innere der Trommel geführt wird.
Die Trommelwand besteht zumeist aus dem von der in Rede stehenden Fabrik in bekannter
Vorzüglichkeit gelieferten gelochten Eisenbleche. Der Theil b², b² enthält Löcher von 15
Millimet. Größe und der ihn umgebende b¹, b¹ solche von 4 Millimet. Durchmesser, so daß
durch letztere Wandung die ganz feinen Staubtheile der Asche fallen, und meist aus
Schlacke bestehend,
dem Verwaschen nicht unterworfen, sondern abgefahren werden. Dadurch, daß die
Wandung b¹, b¹
die b², b²
umgibt, ist die Trommel in ihrer Länge zweckmäßig verkürzt und zugleich ein besseres
Aussieben ermöglicht.
Zwischen b³, b³ und b², b² bei b⁰ besteht die Trommel aus ungelochtem Bleche.
Die Wandung b³, b³ ist mit 25 Millimet., die b⁴, b⁴ mit 45 Millimet. LöchernHr. Vicaire, welcher
eine etwas einfacher eingerichtete, in St. Etienne angewendete Trommel
beschreibt (Bulletin de la Société de
l'industrie minérale, t. X p.
5), gibt deren Lochweiten zu successive 6, 12 1/2, 25 und 50 Millimet.
an. versehen, so daß die ganz großen Aschenstücke am rechten Ende der Trommel
heraus stürzen und ebenfalls abgefahren werden können. Sollen auch diese größten
Stücke der Verarbeitung unterzogen werden, was wohl nur für ganz großen Betrieb sich
lohnen möchte, so wird noch ein Lesetisch hinter die Trommel eingeschaltet, auf
welchen die Stücke vom Ende der Trommel aus herabfallen. Auf diesem Tisch kann dann
durch Klaubarbeit ein directes Auslesen der verwendbaren Kohksstücke bewirkt werden,
während die Schlacken durch einen Abstreicher vom Tische entfernt werden.
Das in den mittleren Abtheilungen angesammelte Material bildet waschfähiges Gut und
wird nach einander auf der Setzmaschine verarbeitet, wodurch man drei verschiedene
Sorten gewaschener Kohks erhält.
Die in Fig. 15
und 16
gezeichnete Aschensetzmaschine ist ebenso construirt, wie diese Maschinen bei den
Aufbereitungsarbeiten gebräuchlich sind; sie besteht aus einem Uförmig gekrümmten Blechgefäße von quadratischem
Querschnitte, in welchem sich Wasser befindet. In dem einen Schenkel des Gefäßes
bewegt sich ein Kolben c auf und nieder, und stößt
dadurch das Wasser durch das den anderen Schenkel abschließende Blechsieb d. Dieser Schenkel trägt einen gußeisernen Aufsatz e, in welchen das Waschgut durch den Trichter f aufgegeben wird.
In Folge der durch das Wasser fortgepflanzten Stoßbewegung sondern sich die
Bestandtheile der Asche nach ihrem specifischen Gewichte; die schweren
Schlackentheile lagern sich unten auf d ab, während die
Kohkstheile sich oben befinden und mit dem über den Rand von e überfließenden Wasser mit in die Rinne g
abgehen, so daß, nachdem das Wasser abgelaufen ist, die zurückbleibenden gewaschenen
Kohks das wieder verwendbare Brennmaterial bilden.
Die auf dem Siebe d nach und nach angesammelten
Schlackenbestände werden nach Abstellen der Maschine ab und zu heraus geschaufelt;
dazu wird durch den Hebel i das Ventil k gehoben und das über d befindliche Wasser
durch das gußeiserne Rohr l in die Cisterne D zurückgelassen. Das nöthige Waschwasser liefert
dieselbe Cisterne, in welcher das gebrauchte Wasser zugleich sich wieder klärt,
durch die mit der Maschine verbundene continuirlich arbeitende Pumpe E. Durch das mittelst Stange zu öffnende Ventil m kann auch das Wasser aus dem Setzkasten in die
Cisterne entfernt und ersterer gereinigt werden.
Die Bewegung der drei Mechanismen, Siebtrommel, Setzkasten und Pumpe geschieht von
der Transmissionswelle aus durch Riemenscheiben. Die Riemenscheibe G mit Losscheibe bewegt die Treibwelle n der Setzmaschine; am Ende dieser Welle n ist eine Kurbel o zum
Betriebe der Pumpe E angebracht.
Der eigenthümliche Bewegungsmechanismus des Kolbens c der
Setzmaschine, zuerst von Berard bei seinen
Kohlensetzkästen angewendet, ist in den Figuren 15 bis 17 möglichst
verdeutlicht. Auf der Betriebswelle n befindet sich am
Ende derselben die Kurbel p, welche mit ihrem
Warzenzapfen in einer geschlitzten, aus zwei Winkeleisen gebildeten Kurbel q, q der zweiten parallel gelagerten Welle r gleitet. Dadurch wird die letztere in eine
oscillirende Bewegung versetzt, und so mittelst der in ihrer Mitte befestigten
Kurbel s die Kolbenstange t
auf- und niederbewegt. Durch diese eigenthümliche Kurbelbewegung ist es
ermöglicht, daß bei gleichförmiger, durch den Pfeil in den Figuren bezeichneter
Rotation der Welle n der Aufgang des Kolbens c mit geringerer Geschwindigkeit stattfindet als der
Niedergang, so daß das Wasser durch das Sieb d kräftig
hindurchgestoßen wird und langsamer zurückfließen kann.
Bezeichnet nämlich ρ den Radius der Kurbel p und λ die
Entfernung der beiden Wellen n und r, so ist das Verhältniß der Geschwindigkeiten des
Kolbens c bei seinem mittleren Stande für den
Auf- und Niedergang = (λ –
ρ)/(λ +
ρ). Nach unseren Messungen ist in runden Zahlen bei der vorliegenden
Setzmaschine λ = 275 Millimet. und ρ = 75 Millimet., also das Verhältniß (λ – ρ)/(λ + ρ) = 4/7. Nach Angaben des Hrn. Vicaire beträgt dagegen bei einer anderen Ausführung λ = 314 Millimet. und ρ = 275 Millimet., wornach also das Verhältniß (λ – ρ)/(λ + ρ) = circa 1/15 außerordentlich klein wäre.Hr. Vicaire gibt ferner
a. a. O. noch folgende Notizen: Umdrehungszahl der Welle F per Minute 22, die der Siebtrommel 12, die der
Betriebswelle des Setzkastens 50. Betriebskraft 1/5 Pferdestärke oder ein
Arbeiter am Schwungrade. Wasserverbrauch täglich 1/3 Ctr. Bedienung ein
Arbeiter und zwei Knaben. Die Kurbel s hat 105 Millimet. Radius, und
beträgt darnach der Kolbenhub von c nur 58 Millimet.
Eine so eingerichtete Wäsche verarbeitet stündlich 15 Schäffel (824 Liter), bedarf
dazu mit Maschinenkraft zwei Arbeiter, mit Menschenkraft vier Arbeiter und kostet
loco Fabrik incl. Verpackung 425 Thlr.
Eine etwas größere Wäsche mit zwei Siebtrommeln, einem Setzkasten und Transmission
kostet 750 Thlr. und verarbeitet stündlich 30 Schäffel (1650 Liter) Asche mit vier
Mann Bedienung. Mit zugehöriger Dampfmaschine ist der Preis 1000 Thlr. und mit
Kessel (als Locomobile) 1380 Thlr.
Aschenwäschen, welche größere Quantitäten zu verarbeiten haben, werden von der
genannten Fabrik in veränderter Anordnung auch so eingerichtet, daß weniger
Bedienung nothwendig ist. Die Siebtrommel ist hoch gelegt, und fallen die gesiebten
Aschen direct in die darunter befindlichen Setzkästen. Das Siebgut wird durch
Paternosterwerk gehoben. Eine solche Wäsche mit Siebtrommel und zwei Waschkästen
verarbeitet stündlich 40 Schäffel (2200 Liter) und kostet 1275 Thlr. Bedienung zwei
Mann. Mit Dampfmaschine 1525 Thlr. (mit Kessel 2025 Thlr.)
Bei einer ganz großen Wäsche sind auch die Setzkästen erhöht postirt und zum
Transport Förderwagen auf Schienen benutzt, ferner ein Lesetisch angeordnet.
Leistung 60 Schäffel (3300 Liter), Bedienung drei Arbeiter. Preis 1750 Thlr., mit
Dampfmaschine 2100 und mit Kessel 2650 Thlr.
Solcher Wäschen ist bereits eine große Anzahl im Betriebe, und werden aus
gewöhnlichen Aschen circa 66 Proc. Kohks ausgewaschen,
von denen der Centner incl. Betriebskraft, 5 Proc. Zinsen und 20 Proc. Amortisation
des Anlagecapitals, auf circa 1/2 Sgr. zu stehen kommen
soll.
Tafeln