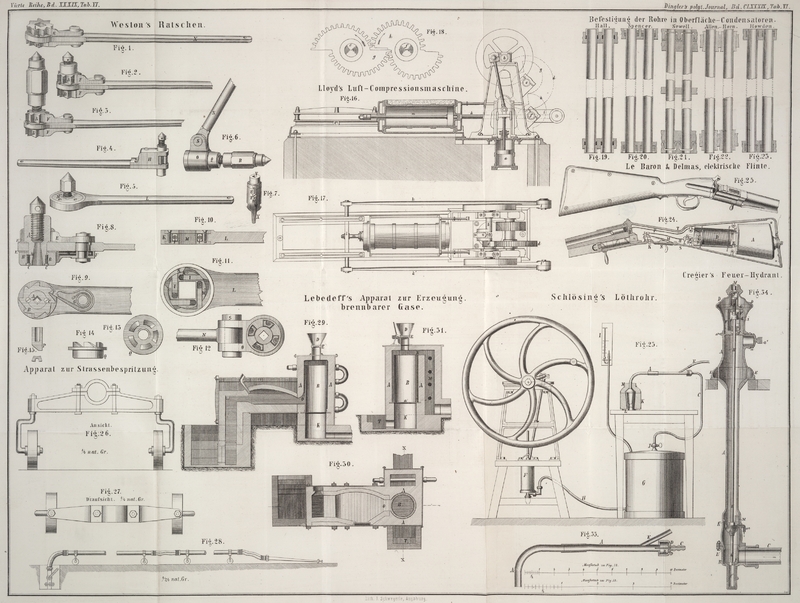| Titel: | Die Feuer-Hydranten in Chicago. |
| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. XCIII., S. 367 |
| Download: | XML |
XCIII.
Die Feuer-Hydranten in
Chicago.
Nach einer Mittheilung im Engineering, Mai 1868, S.
488.
Mit einer Abbildung auf Tab. VI.
Die Feuer-Hydranten in Chicago.
Die Wasserleitungen mit hohem Drucke erlangen durch ihre allgemeine Einführung immer
größere Bedeutung und da bei der Anlage dieser Werke ein Hauptgewicht auf die
Feuerkrahne oder sogenannten Feuer-Hydranten zu legen ist, theilen wir einen
solchen mit, wie er von Dewitt und Cregier für die Stadt Chicago entworfen und in großer Anzahl ausgeführt
wurde. Dieselben haben sich während mehrjähriger Benutzung vorzüglich bewährt; sie
sind leicht zu bedienen, selten Reparaturen unterworfen, für Einwirkung des Frostes unempfindlich und
haben eine besondere Einrichtung, welche ihre Wegnahme gestattet ohne die an
demselben Rohrstrange liegende Nachbarschaft von der Verbindung mit dem Hauptrohre
abschließen zu müssen.
In Figur 34
ist ein solcher Hydrant im Durchschnitt abgebildet.
Das Steigrohr A erweitert sich an dem Theile, welcher
über dem Straßenpflaster vorsteht und ist durch den übergeschobenen Ring E, der mit vier Steinschrauben auf der Umfassung der
Kammer befestigt ist, in seiner Stellung gehalten. An dem freistehenden Säulchen ist
der Stutzen a mit Schlauchschraube angegossen; er ist
bei dem Nichtgebrauch durch die Schraube a′
verschlossen; das Steigrohr A erhebt sich nur bis zu dem
Stutzen a und ist über demselben abgeschlossen; seine
Flansche a2 stützt den
mit vier Schrauben befestigten Aufsatz D; die beiden
Arme F zur Befestigung der Mutter G stehen über der Flansche a2 vor. Die Ventilstange H geht zwischen den Armen F durch die
Stopfbüchse f; ihr Kopf J
ist mit der Schraube g durch eine Klaue derart
verbunden, daß sie sich mit derselben hebt und senkt, deren drehender Bewegung
jedoch nicht folgt. Die durch die Mutter G gehende
Schraube g hat einen viereckigen Kopf, welcher innerhalb
der viereckigen Höhlung der Hülfe g′ gleitet. Das
Ventil h läßt sich nach Belieben öffnen und schließen,
wenn man die Hülse g′ an dem oben in einer
Vertiefung des Aufsatzes D vorstehenden Zapfen mit einem
Schlüssel umdreht.
An dem vorstehenden Arme F ist ein Führungskeil mittelst
der Schraube i befestigt; derselbe greift in eine Nuth
des Ventilstange-Kopfes J und verhindert so, daß
sich die Ventilstange H drehe.
Im unteren Theile des Steigrohres A ist der Ventilsitz
K für das Ventil h
befestigt; derselbe dient auch als Sitz für das kleine Ablaßventilchen M, dessen Ausfluß durch das Röhrchen m in die Kammer stattfindet. Der Ventilstift von M ist oben umgebogen und führt wieder abwärts bis auf
das Ventil h. Senkt sich das letztere, so geht der Stift
mit nieder, wobei sich das Ventilchen schließt. Wird das Ventil h wieder gegen seinen Sitz gehoben, so stößt es gegen
den Stift von M, das Ablaßventilchen hebt sich und der
Inhalt des Steigrohres ergießt sich durch das Röhrchen m
in die Kammer.
Das Zwischenstück B trägt auf seiner oberen Flansche den
Hydrant und setzt ihn durch seinen Muff mit dem Wasserleitungsrohr C in Verbindung. Innerhalb der oberen Oeffnung
ist der Ventilsitz L. eingeschraubt, gegen welchen sich
das Ventil 1 dicht anlegt, wenn es mittelst der Schraube, die an seinem verlängerten
Stiele l′ angeschnitten ist, emporgeschraubt wird. Die
Mutter dieser Schraube liegt in dem Anguß b.
Das Ventil l wird nur dann geschlossen, wenn der Hydrant
wegen Reparatur oder aus anderem Grunde entfernt werden soll. Man schraubt in diesem
Falle den Aufsatz D ab, löst die Schraube i, wobei der Führungskeil aus der Nuth des Kopfes J fällt, und dreht letzteren mit einem Hakenschlüssel.
— Die verlängerte Ventilstange H hat an ihrem
Ende einen viereckigen Kopf h′, der sich in dem
langen viereckigen Loche des Ventiles l passend schiebt,
und bei der Drehung der Stange H das Ventil aus seiner
Mutter gegen den Sitz hebt und dicht verschließt.
G.
M.
Tafeln