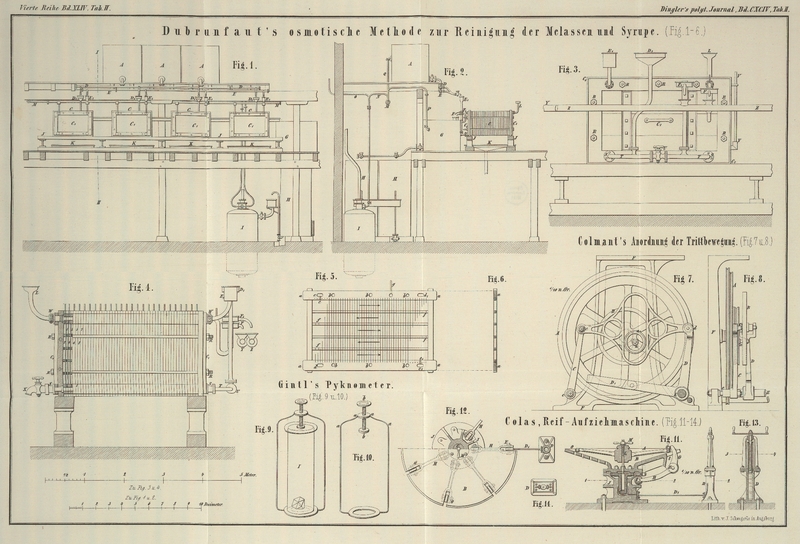| Titel: | Modification des Pyknometers; von Dr. Wilhelm Friedr. Gintl. |
| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. XV., S. 43 |
| Download: | XML |
XV.
Modification des Pyknometers; von Dr. Wilhelm Friedr. Gintl.Aus Fresenius
Zeitschrift für analytische Chemie Jahrgang VIII, vom
Verf. mitgetheilt.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Gintl, Modification des Pyknometers.
Jeder der irgend öfter in die Lage gekommen ist, das specifische Gewicht fester oder
flüssiger Körper mit Hülfe des Pyknometers bestimmen zu müssen, wird mir zustimmen,
wenn ich behaupte, daß dergleichen Bestimmungen immer ihr Mißliches haben und ich
dürfte wohl kaum der Einzige seyn, der gerade dieser Methode der Bestimmung
specifischer Gewichte den Vorwurf einer zu dem Grade der erreichbaren Genauigkeit in
keinem Verhältnisse stehenden Umständlichkeit macht. Von den gebräuchlichsten Formen
des Pyknometers sind jene, welche zur Erreichung einer vollständigen Füllung mit
einem längeren oder kürzeren, durchbohrten Glaspfropfen, so wie die, welche mit
einer durchbohrten Platte verschließbar sind, allerdings, namentlich da, wo nur
wenig Substanz zur Verfügung steht, oder es sich um flüchtige Substanzen handelt,
jenen Formen vorzuziehen, wo die Größe des Volums durch Auffüllen bis zu einer Marke
oder Ablesen an einer Scala bestimmt wird; indeß haften denselben immerhin
Uebelstände an, die leicht zu irrigen Resultaten führen können. So ist es
beispielsweise kaum möglich, zumal bei Anwendung einer etwa leichter flüchtigen
Flüssigkeit, in Folge der fortwährend statthabenden Verdunstung des
Pyknometerinhaltes, ein constantes Gewicht zu bekommen, und wenn schon dieses Moment
die Sicherheit der Gewichtsbestimmung illusorisch macht, so ist das um vieles mehr
bezüglich des Umstandes der Fall, daß sich bei dem vor der Wägung nöthigen sorgfältigen Reinigen
des Pyknometers an der Außenseite u.s.f. ein Anfassen desselben und also eine durch
die Körperwärme bedingte Temperaturerhöhung des Pyknometers und seines Inhaltes kaum
vermeiden läßt, deren nächste Folge die seyn wird, daß ein Theil der durch die
Wärmezufuhr ihr Volum vergrößernden Flüssigkeit aus dem Pyknometer austreten wird,
und dieses also nach dem Wiedereintritt der vorigen Temperatur in Folge der nunmehr
eintretenden Volumenverminderung der Flüssigkeit von dieser nicht mehr völlig
erfüllt werden wird. Deßhalb ist es ja auch eine der Hauptregeln für derartige
Bestimmungen spec. Gewichte, sey es flüssiger Körper, sey es fester, das Pyknometer
möglichst wenig anzulassen und also jede Temperaturerhöhung zu vermeiden; eine
Regel, die freilich leichter ausgesprochen als eingehalten ist. Die Größe der durch
dergleichen Zufälligkeiten bedingten Fehler, die sich allerdings in bekannter, das
Verfahren aber nicht vereinfachender Weise, wenigstens theilweise corrigiren lassen,
mag wohl in vielen Fällen, Zumal bei irgend sorgfältigerer Ausführung der
Bestimmungen, kaum in die Waagschale fallen, aber in Fällen, wo zumal wenig Substanz
zur Verfügung steht, oder wo es eine flüchtigere Flüssigkeit ist, um deren
Untersuchung es sich handelt, können selbst bei thunlicher Vorsicht solche
Zufälligkeiten hinreichen, das Resultat schon in der ersten Decimale zu alteriren,
was kaum gleichgültig seyn kann; oder sie sind doch geeignet, selbst wenn ihr
Einfluß kein so bedeutender seyn sollte, bei der Ausführung von derartigen
Bestimmungen recht lästig zu werden. Das Streben, möglicher Weise eine größere
Genauigkeit der Resultate derartiger Bestimmungen zu erreichen, ohne das Verfahren
zu compliciren und zugleich von derartigen Zufälligkeiten weniger belästigt zu seyn,
ließ mich bereits vor geraumer Zeit eine kleine Abänderung an dem Pyknometer
ausführen, die, wenn ich ihr auch keineswegs den Namen einer Verbesserung vindiciren
will, sich als recht bequem bewährt hat, und also geeignet seyn dürfte. Manchem,
der, wie ich, oft in die Lage kommt, dergleichen Bestimmungen ausführen zu müssen,
von einigem Vortheile zu seyn.
Ich gebe im Folgenden eine kurze Beschreibung des Pyknometers, dessen ich mich
bediene. Ich verwende ein kleines (die Dimensionen sind ziemlich gleichgültig)
cylindrisches Glasgefäß mit ebenem Boden (I, Fig. 9), möglichst leicht,
dessen Mündung mit einem gut aufgeschliffenen runden Glasplättchen verschließbar
ist, das ich, um der Verdunstung nicht unnützer Weise mehr Raum zu geben,
undurchbohrt wähle. Zu diesem Gefäße passend, habe ich mir eine, einem Steigbügel
nicht unähnliche, kleine Vorrichtung aus vergoldetem Messingblech angebracht, die an
ihrem Kopftheile (a, a, a, a, Fig. 10) an einer durch
ein aufgelöthetes Messingplättchen verstärkten Stelle eine mit einem nicht zu groben Gewinde
versehene Schraube trägt, an deren nach abwärts gerichtetem Ende sich ein kleines,
um die Achse des Schraubenstiftes bewegliches Scheibchen befindet. Der Untertheil
der bügelartigen Vorrichtung wird von einem horizontalen flachen Ringe gebildet,
dessen Lumen kleiner ist als die Bodenfläche des Pyknometers, so daß dieses auf den
ringförmigen Boden aufgesetzt und, mit dem Deckplättchen verschlossen, durch einen
mittelst der Schraube des Kopftheiles auf das Deckplättchen ausgeübten Druck
einerseits völlig festgeklemmt werden kann, während andererseits gleichzeitig das
Deckplättchen fest an die Mündung des Gefäßes angedrückt und dieses also, bei sonst
gut aufgeschliffener Deckplatte, völlig sicher verschlossen wird. Der Zweck dieser
Einrichtung ist wohl ohne weiteres verständlich. Behufs der Füllung und des
Verschließens des Pyknometers verfahre ich, nachdem ich zuvor in bekannter Weise für
die Entfernung von Luftblasen von den Wandungen etc. gesorgt habe, endlich so, wie
man gewöhnlich bei der Füllung und dem Verschließen der Beobachtungsröhren für
Circularpolarisation u. d. a. vorzugehen pflegt, stelle dann das Pyknometer,
dasselbe mittelst eines mehrfach zusammengelegten Papierstreifens haltend, in die
Klemmvorrichtung ein und sorge nun, während ich das durch einige
Schraubenumdrehungen fixirte Gefäß an dem Schraubenkopfe der Klemmvorrichtung halten
und beliebig drehen und wenden kann, für eine sorgfältige Reinigung desselben von
anhängender Flüssigkeit.
Das die ganze Einrichtung, die, wie man leicht einsieht, wesentlich bloß möglichste
Vermeidung jedweder Temperaturerhöhung und sicheren Verschluß ohne Verzicht auf
leichte und bequeme Handhabung bezweckt. Es hieße wohl Eulen nach Athen tragen, wenn
ich durch Zahlenbelege, die mir übrigens in genügender Anzahl zu Gebote stehen, die
Brauchbarkeit des Instrumentchens irgend weiter darlegen wollte, und es erübrigt mir
also nur noch hervorzuheben, daß das so modificirte Pyknometer, das natürlich sammt
der Klemme gewogen wird, wenn die Klemmvorrichtung nicht überflüssig massiv
gearbeitet ist, sich bei mittleren Dimensionen ganz bequem auf einer gewöhnlichen,
selbst bloß für geringere Belastungen verwendbaren Waage wägen läßt, da es selbst in
völlig gefülltem Zustande sammt Klemme höchstens 15–20 Grm. zu wiegen
pflegt.
Prag, 23. Februar 1869.
Tafeln