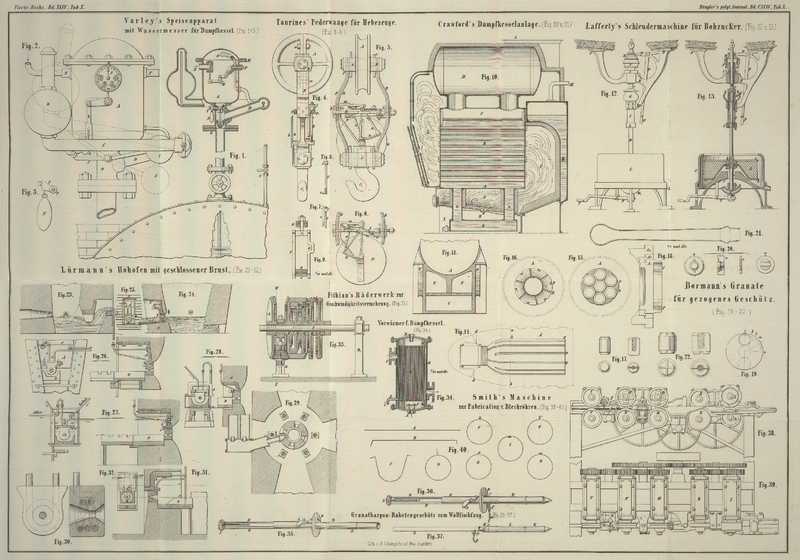| Titel: | Taurines' Federwaage für Hebezeuge. |
| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. XCV., S. 471 |
| Download: | XML |
XCV.
Taurines' Federwaage
für Hebezeuge.
Nach Armengaud's Génie industriel, October 1869, S.
208.
Mit Abbildungen auf Tab.
X.
Taurines' Federwaage für Hebezeuge.
Um bei Verladungen mit Hülfe von Krahnen oder anderen Hebezeugen das Gewicht von
Colli, Maschinenbestandtheilen etc. sofort zu erhalten, hat man Wägapparate
construirt, wovon ein in den Figuren 4–8 abgebildetes
System im Princip aus einer mit dem Krahnhaken in Verbindung gebrachten Federwaage
besteht, welche nebstbei auch als Zugdynamometer benutzt werden kann.
Wie die Abbildungen zeigen, besteht A, die unterste
Spurrolle, welche zur Aufnahme der Krahnkette bestimmt ist, aus zwei mit Bolzen a zusammengehaltenen Hälften; sie lauft lose auf der
Achse B, deren viereckige Enden zur Befestigung der
Zugfedern R dienen.
Die beiden Hauptfedern R sind von gleichmäßiger Stärke
und an dem oberen Ende mit Hülfe von Keilen c in zwei
Schlitzen der Achse B ohne Gestattung irgend eines
Spielraumes befestigt. Außerdem sind die, je nach der Stärke aus mehr oder weniger
Lamellen zusammengesetzten Federn oben durchlocht und wird die Verbindung der Federn
mit der Achse B durch einen durchgehenden Bolzen e noch sicherer.
Wie man sieht, sind die Theile f, g und g, h der Federn nach entgegengerichteten Kreislinien
geformt, welche bis zur Mittelachse in gerade Linien auslaufen; die untere Hälfte
ist symmetrisch und ebenso solid wie oben mit dem unteren Querstück C verbunden, an welchem ein Haken oder eine Oese C' sitzt.
Das in 1/10 wirklicher Größe dargestellte Dynamometer ist für eine Maximalbelastung
von 5000 Kilogrammen berechnet, bei welcher die Federn R
in Folge der Ausbiegung eine Verlängerung von 5 Millimeter erleiden, resp. die
Näherung in der Mitte bei i, i circa 20 Millimeter
beträgt.
Dieses Zusammengehen wächst in geringerem Maaße als die Belastung, auch ist dasselbe
anfänglich nicht genügend, um direct einem Zeiger am Zifferblatte eine hinreichende
Abweichung zu gestatten, weßhalb folgende Uebersetzung dieser Bewegung
stattfindet.
Zur Befestigung der Stücke m und n sind die Federn in der Mitte gerade geformt. Am ersteren, d. i. m, ist eine Plattfeder r von
120 Millimeter Länge angebracht; das Ende r' dieser
Feder ist mit einem schräg gehenden Theil s verbunden,
dessen mit t bezeichnetes Ende eine zweite an dem Theil
n angeschraubte Feder r² – 190 Millimet. lang – trägt.
Der Abstand der Federn r und r² beträgt 555 Millimet. Mit dem Ende t
der letzteren steht ein gekrümmtes nach unten gerichtetes Stück u in Verbindung, welches mit Hülfe einer weiteren Feder
v (Fig. 7 u. 8) den gezahnten Sector
E um den Drehpunkt j mit
sich führt. In der Ruhelage fällt dieser Drehpunkt mit der Mitte der Feder r zusammen.
Durch die im Vorhergehenden beschriebene Anordnung stehen also alle Theile des
Dynamometers von den Hauptfedern bis zum Triebwerk in fester Verbindung und ist der
Apparat stets zum Gebrauch vorbereitet.
Der Sector E, auf welchen eine Bewegung von 90 bis 100
Millimeter für 20 Millimet. Einbiegung der Federn R
übertragen wird, greift in ein Getriebe ein, an dessen Achse der Zeiger b die betreffende Belastung am Zifferblatt D anzeigt.
In Figur 6 ist
die Stellung des Federwerkes für die Maximalbelastung ersichtlich gemacht, bei
welcher die Federn r und r² die größte Veränderung erleiden und das Verbindungsstück s um circa 25 Grad abgelenkt
wird.
Sobald die Maximalbelastung eintritt, wird die in Fig. 9 dargestellte
Arretirungsvorrichtung wirksam. Der Rahmen y, y' mit den
Querstücken x, x' verhindert alsdann ein weiteres
Zusammengehen der Federn, somit eine Veränderung des Triebwerkes.
Der Apparat ist wohl leicht anzubringen und seine ganze Höhe gering, da das Federwerk
direct an der Rolle A angebracht ist. Dieß bietet jedoch
andererseits den Nachtheil, daß die Waage in steter Verbindung mit dem Krahn bleibt,
weßhalb man auch solche Waagen baut, welche beliebig an dem Krahnhaken aufgehängt werden, wenn
man eben das Gewicht der Last bestimmen will; diese hängt sodann an einem an der
Waage angebrachten Haken.
J. Z.
Tafeln