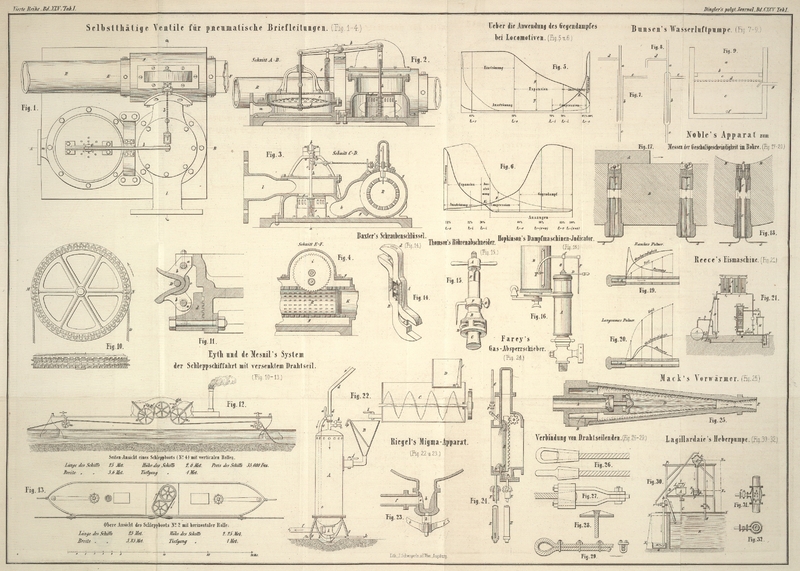| Titel: | Lagillardaie's Heberpumpe. |
| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. X., S. 32 |
| Download: | XML |
X.
Lagillardaie's Heberpumpe.
Nach Armengaud's Génie industriel, October 1869, S.
169.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Lagillardaie's Heberpumpe.
Die im Folgenden beschriebene Heberpumpe (pompe-siphon oder siphon aspirant)
gestattet die directe Anwendung eines Gefälles, mit Umgehung aller durch dasselbe
getriebenen Motoren, behufs Hebung einer der betreibenden gleichartigen oder
verschiedenen Flüssigkeit.
Diese Heberpumpe, Fig. 30–32, besteht der
Hauptsache nach aus Zwei Winkelhebern a, b, c und e, f, g, welche jedoch nicht unter den gewöhnlichen
Umständen functioniren, sondern deren Wirkungsweise dadurch erheblich modificirt
wird, daß die Heberarme theilweise mit Flüssigkeit allein, theilweise mit einem
Gemisch derselben mit Luft gefüllt sind.
Durch den Heber e, f, g wird Flüssigkeit von dem Niveau
N auf das Niveau N''
gehoben; um in demselben eine Circulation der Flüssigkeit im Sinne der Pfeile zu
ermöglichen, wird am unteren Ende des Steigrohres f, g
durch den Hahn r' Luft in fein vertheiltem Zustande
eingelassen. Dieselbe vermischt sich mit der Flüssigkeit und sondert sich von
letzterer in dem Gefäße A' dem Vertheiler (Distributeur), wieder ab, um aus
demselben durch das Rohr i, r wieder ausgesaugt zu
werden, während die abgeschiedene Flüssigkeit im Ausflußrohre e, f nach abwärts strömt, und ein Steigen, resp. Nachströmen des
specifisch leichteren Gemisches von Luft und Flüssigkeit zur Folge hat. Das bei r einströmende Luftquantum muß so regulirt werden, daß
das Product aus dem specifischen Gewichte des Gemisches in die Höhe N
N''' kleiner ist als jenes aus dem specifischen Gewichte
der Flüssigkeit in die Höhe N'
'
N'''. Der im Heber e, f, g
stattfindende Vorgang ist dadurch bedingt, daß die im Vertheiler A' sich abscheidende Luft ausgesaugt wird, und daß die
Spannung derselben um einen der Flüssigkeitssäule f, e
(N'' N''') entsprechenden hydrostatischen Druck
kleiner ist als jener der äußeren Atmosphäre.
Der Heber a, b, c dient dazu, die Luft aus dem Vertheiler
A' auszusaugen und ihren Druck in der erwähnten
Weise unter jenen der Atmosphäre zu bringen. Zu diesem Zwecke ist der Luftraum des
Vertheilers durch das Rohr i, r mit dem oberen Ende des
Heberarmes a, b verbunden; die Luft wird in denselben
eingesaugt, mischt sich mit der abwärtsströmenden Flüssigkeit, und gelangt bei a durch das Unterwasser in's Freie.
Damit die beiden Heber in der angedeuteten Weise functioniren können, ist es
nothwendig daß in den Röhren g, f und a, b die Luft der Flüssigkeit in fein vertheiltem
Zustande beigemischt sey. Um dieß zu erzielen, läßt Lagillardaie erstere bei r und r' nicht direct in die Röhren einströmen, sondern
schaltet in dieselben durchlöcherte mit einem Mantel umgebene Rohrstutzen (Fig. 31) ein,
welche die Bildung größerer Luftblasen verhindern.
Zum Anlassen der Pumpe dient das Gefäß A, der Amorceur, welcher einerseits durch das Rohr C mit dem Oberwasser R des
disponiblen Gefälles, andererseits durch das Rohr D mit
dem Heber a, b, c in Verbindung steht. Mit Hülfe des Amorceur wird die Pumpe (vorausgesetzt daß alle Hähne geschlossen sind)
in folgender Weise in Betrieb gesetzt. Man öffnet die Hähne j und j' und füllt den Amorceur durch den Trichter l, schließt
hierauf dieselben und stellt durch Oeffnen des Hahnes k
die Verbindung des Amorceur mit dem Oberwasser her. Der
Amorceur entleert sich theilweise, und die hierdurch
entstehende Luftverdünnung in demselben und in den Armen des Hebers a, b, c hat die Füllung und Ingangsetzung des letzteren
zur Folge, welche ihrerseits wieder die theilweise Füllung des Amorceur nach sich zieht.
Nach Verlauf dieses Vorganges öffnet man den Hahn r'; die
im Vertheiler A' befindliche Luft wird durch das Rohr
i, r ausgesaugt, die zwei Arme des Hebers e, f, g füllen sich theilweise, worauf der letztere
durch Oeffnen des Hahnes r' in Betrieb gesetzt wird.
Als Vortheile der beschriebenen Pumpe kann man, abgesehen davon daß man durch sie in
den Stand gesetzt ist ohne Anwendung einer Kraftmaschine Wasser zu heben, den
Umstand bezeichnen, daß die zu hebende Flüssigkeit von jener des Gefälles
verschieden seyn, und daß sich ohne Kraftverlust der Pumpenheber e, f, g in bedeutender Entfernung von dem Gefälle
befinden kann. Die letztgenannten zwei Vortheile hat die vorliegende Pumpe vor Nagel's WasserstrahlpumpePolytechn. Journal, 1865, Bd. CLXXVII S. 267. voraus, welche jedoch wegen Einfachheit ihrer Construction vor jener in dem
Falle den Vorzug verdient, wo Gefälle und Saughöhe sich nebeneinander befinden.
Tafeln