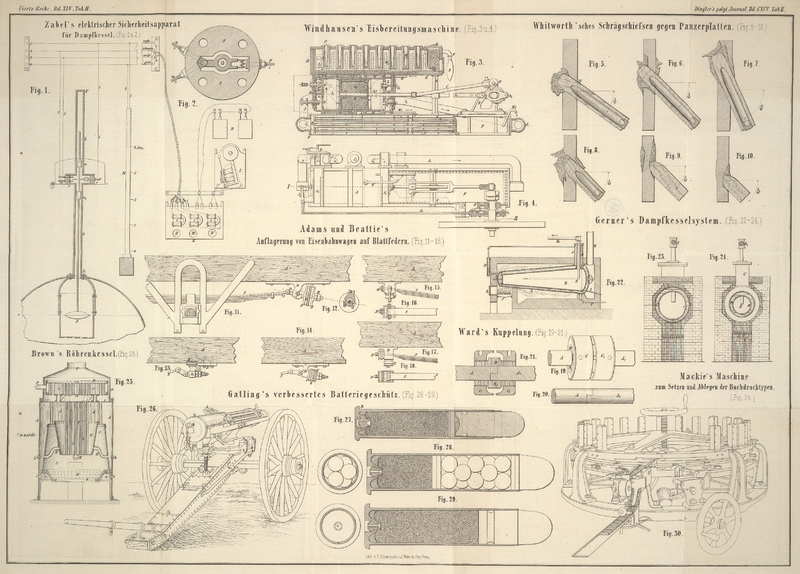| Titel: | Elektrischer Sicherheitsapparat für Dampfkessel; von Otto Zabel in Quedlinburg. |
| Autor: | Otto Zabel |
| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. XXVI., S. 103 |
| Download: | XML |
XXVI.
Elektrischer Sicherheitsapparat für Dampfkessel;
von Otto Zabel in
Quedlinburg.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Zabel's elektrischer Sicherheitsapparat für
Dampfkessel.
Die bisherigen Sicherheitsapparate bezweckten lediglich, einen zu geringen
Wasserstand durch eine Dampfpfeife zu signalisiren. Beim Black'schen Apparat muß der Dampf erst einen Metallpfropfen schmelzen, um
zur Pfeife gelangen zu können. Der Schmelzpunkt dieser Pfropfen ist häufig
verschieden, und außerdem hat sich noch herausgestellt, daß sich derselbe im Lauf
der Zeit verändert; dazu kommt die Kostspieligkeit der Pfropfen selbst und die
Umständlichkeit der Einsetzung eines neuen Pfropfens nach jeder Function des
Apparates. Der Black'sche Apparat bietet demnach weniger
Sicherheit als die gewöhnlichen Schwimmerpfeifen; diese haben jedoch den Uebelstand,
daß sie häufig undicht werden und daß der Heizer das Signal, ehe es zur vollen
Wirkung gelangt, zuerst hört und es somit in der Hand hat, durch Umwickeln der
Pfeife das Signal zu ersticken. Der in Fig. 1 und 2 abgebildete elektrische
Apparat hat alle diese Uebelstände nicht. Das Signal wird nur von den betreffenden
Aufsichtsbeamten gehört, und bezieht sich dieses nicht allein auf zu niedrigen
Wasserstand im Kessel, sondern auch auf zu hohen Wasserstand und zu hohen
Dampfdruck. Außerdem wird jeder der drei angeführten anormalen Zustände angezeigt
durch eine niederfallende Klappe, die mit dem betreffenden Vermerk versehen ist;
diese Vorfälle lassen sich demnach auch noch nachträglich constatiren, nachdem das
Signal aufgehört hat zu tönen.
Im Kessel befindet sich ein Schwimmer R; damit derselbe
von den Wallungen des Wassers nicht beeinträchtigt wird, schwimmt er in einer oben
offenen Büchse, in welcher das Wasser von unten durch einen gelochten Boden langsam
ein- und austritt. Dieser Schwimmer trägt eine Stange mit den verstellbaren
Führungen a und a'. Die
Stange bewegt sich ohne Stopfbüchse frei in dem auf dem Kessel stehenden Rohre N, N'. Zwischen den Flanschen der Rohre N, N' ist eine Metallscheibe S,
S (in Fig.
2 in größerem Maaßstab im Grundriß dargestellt) dampfdicht eingeschraubt.
Diese Metallscheibe enthält die beiden isolirten Schrauben n und m, welche innerhalb der Scheibe eine
Gabel bilden; an der gegenüberliegenden Seite befindet sich die ebenfalls isolirte
Schraube P mit einer Spiralfeder; an dieser ist eine
Metallzunge befestigt, die zwischen der durch die Schrauben n und
m gebildeten Gabel spielt und in der Mitte eine
Oeffnung zum freien Durchgang der Schwimmerstange hat. Die Führungen a und a' werden so weit von
einander festgestellt, als man den Heizern Spielraum im Wasserstand gestatten will;
sie dienen als Mitnehmer der Zunge, um diese mit der Schraube n oder m in Berührung zu bringen.
Ueber den Kesseln befinden sich die Hauptdrähte, welche, bevor sie in die Fabrikräume
weiter geführt werden, der leichteren Isolation und Legung halber zu einem Kabel von
4 verschiedenartig gefärbten Drähten vereinigt sind. In irgend einem Fabriklocal,
Comptoir, Aufseherwohnung etc. befindet sich eine elektrische Batterie B, ein elektrisches Läutewerk L und ein Anzeigkasten K. Es kann jedoch auch
der Anzeigkasten im Comptoir, die Glocke dagegen an irgend einem anderen Platz
angebracht werden. Jeder Kessel, resp. die in der Scheibe S,
S befindlichen Schrauben n, m und P, sind mit den Hauptdrähten über den Kesseln durch
angelöthete Nebendrähte verbunden; ebenso sind die Kabeldrähte mit Batterie,
Läutewerk und Anzeigkasten verbunden.
Steigt nun das Wasser im Kessel über die festgesetzte Höhe, so wird die Führung a' die Zunge gegen die obere Schraube n drücken und die Batterie schließen; das Läutewerk L beginnt zu tönen und gleichzeitig fällt an dem
Anzeigkasten K vor die Oeffnung II eine Platte, welche
die Worte „zu viel Wasser“ trägt. So lange der Wasserstand zu
hoch ist, bleibt die Batterie geschlossen; das Läuten hört erst dann auf, wenn der
Wasserstand im Kessel und mit demselben die Führung a'
gesunken und so die Zunge in ihre frühere Lage zurückgefedert ist. Die Anzeigplatte
wird so lange dem Auge sichtbar bleiben, bis dieselbe zurückgestellt wird; der
stattgefundene zu hohe Wasserstand kann also auch noch nachträglich constatirt
werden, wenn die Glocke nicht gehört seyn sollte. Bei zu geringem Wasserstand im
Kessel wird die Führung a die Zunge mit nach unten
nehmen und dieselbe gegen die Schraube m drücken. Sofort
wird das Läutewerk ertönen und eine Platte mit der Inschrift: „zu wenig
Wasser“ wird vor die Oeffnung III fallen. Steigt das Wasser, so
verläßt die Führung a die Zunge wieder, diese kehrt in
ihre mittlere Lage zurück und die Glocke wird aufhören zu läuten, wogegen die
Anzeigplatte bis zur Wegnahme sichtbar bleibt.
Um auch zu hohen Dampfdruck signalisiren zu können, schiebt man durch die obere
Oeffnung des Quecksilbermanometers M zwei isolirte
Drähte bis zu dem zu signalisirenden Dampfdruck. Sobald letzterer eintritt, wird das
Quecksilber die beiden Drähte berühren und die Batterie schließen; sofort ertönt das
Läutewerk und vor die Oeffnung IV des Anzeigkastens fällt eine Platte mit der Inschrift:
„zu viel Dampf“. – Derartige Läutewerke und
Anzeigkästen lassen sich beliebig viele in verschiedenen Räumen anbringen und werden
sie alle gleichzeitig functioniren. Auch im Kesselhaus selbst kann ein Läutewerk
angebracht werden.
Soll ein Kessel abgelassen werden, so schraubt man, damit das Läutewerk nicht
fortwährend tönt, den betreffenden Draht an der Schraube m los. Eine mit Verschluß versehene Metallumhüllung verhindert, daß Heizer
und unberufene Personen an die Schrauben n, m und P geangen können.
Alle Drahtverbindungen müssen zusammengelöthet werden. Die Batterie ist jährlich
einmal zu reinigen und frisch zu füllen, bedarf jedoch während dieser Zeit keiner
besonderen Aufsicht.
Bis auf weitere Bekanntmachung sind diese Apparate nur allein von mir zu beziehen;
der Preis desselben beträgt pro Kessel 15 Thlr., für
einmalige Anlage der Leitung, Batterie, Läutewerk, Anzeigkasten 25 Thlr., großes
Läutewerk mit doppelter Batterie 15 Thlr. mehr. Ist mehr als 100' Kabellänge
erforderlich, so wird für jeden Fuß darüber 2 Sgr. berechnet. 6 Kesselapparate
kosteten demnach 6 mal 15 plus 25 Thlr. Ausgeführte
Anlagen können unter anderen in nachstehenden Fabriken angesehen werden:
Actieneisenwerk in Salzgitter, Zuckerfabriken: Brandes
und Comp. in Offleben bei Schöningen, Brandes und Basel in
Hötensleben, Actienzuckerfabrik Jerxheim, Kücken und Schmidt in Wulferstedt, Wiersdorff,
Hecker und Comp. in Gröningen, Gustav Mehne in Säbischdorf bei Schweidnitz, M. W. Heimann in Breslau, Lüdecke
und Comp. in Landsberg, Zuckerfabrik Schwittersdorf bei
Eisleben, Zuckerfabrik Erdeborn bei Eisleben, Wulsch,
Förster und Comp. in Schwanebeck, Lafferder
Actienzuckerfabrik, W. A. Rimpau in Schlanstedt, R. Weinlig in Quedlinburg, H. Schliephake und Comp. in Dedeleben,
Zuckerfabrik Alsleben in Alsleben a. S., Zuckerfabrik Besedau bei Alsleben a. S.,
Zuckersiederei-Comp. in Bernburg, Hartwigswaldauer Zuckerfabrik bei Jauer,
Zuckersiederei Gutschdorf bei Striegau, C. E. Walkhoff in
Schosnitz bei Canth, Zuckerfabrik Klettendorf bei Breslau, Gräfl. Stollberg'sche Maschinenfabrik in Magdeburg,
Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Werkstatt in Halberstadt, Emil Soltmann's Eisenwerk Thale, Zuckerfabriken in Garden und
Pyritz etc.
Tafeln