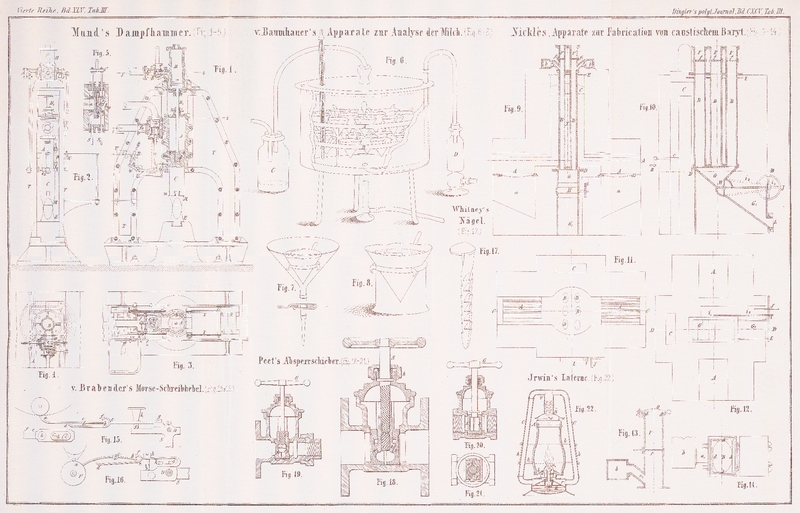| Titel: | Irwin's Lampe oder Laterne zum Brennen von Mineralölen. |
| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. XXXV., S. 119 |
| Download: | XML |
XXXV.
Irwin's Lampe oder Laterne zum Brennen von
Mineralölen.
Aus Armengaud'sGénie industriel, November 1869,
S.
Mit einer Abbildung auf Tab. III.
Irwin's Lampe oder Laterne.
Zum Brennen von sehr kohlenstoffreichen Oelen hat J. H. Irwin in Chicago (Staat Illinois, Amerika) ein System von Lampen oder
Laternen erfunden und sich kürzlich in Frankreich patentiren lassen, wobei ein durch
die Flamme erzeugter Luftstrom mit dieser zusammentrifft und eine vollständigere
Verbrennung bewirkt.
Bei einer nach diesem Princip construirten Lampe oder Laterne, wie sie in Fig. 22 im
Verticalschnitt dargestellt ist, erhält der Deckel des Oelbehälters R eine conische Form und um ihn herum ist eine
Luftkammer r gebildet, welche die Luft aus den
Leitungsröhren C empfängt und sie der Flamme zuführt.
Der Brenner hat die bei Mineralöllampen gewöhnliche Form, nur sind oben am
Dochthalter Vorsprünge a angebracht, um die Bewegung und
Richtung der zuströmenden Luft in gewissem Grad zu reguliren. Diese Vorsprünge
können dadurch ersetzt werden, daß der obere Theil des Dochthalters zu einer Art
Schale nach außen gebogen wird. Die conische Kapsel a¹ über dem Brenner, welche oben die gewöhnliche Form hat, ist unten
luftdicht mit der Luftkammer r verbunden; auf dieser
Kapsel ruht der durchlochte Träger b des Glascylinders,
der eine concave Form erhält, um den starken Zutritt seitlicher Luftströmungen zu
verhüten, und der einen etwas kleineren Durchmesser besitzt als der Deckel der
Luftkammer r. Der Ring A auf
dem oberen Ende des Glascylinders, der aus einem Blechstück ohne Löthung geformt
ist, trägt mittelst der kleinen Stützen c den Hut B; die Stützen enden dazu in kleine Zapfen, die in
Löcher des Deckels eingenietet oder sonst wie ohne Löthung befestigt sind. Der Hut
steht durch das Rohr T mit den beiden Luftröhren C in Verbindung. Die Verbindung zwischen dem Hute und
dem Rohre T geschieht durch ein aufgeschraubtes
Rohrstück; schraubt man dieses ab, so kann man den Glascylinder vom Brenner
entfernen. Für gewöhnliche Zwecke genügen zwei Luftröhren C; für Straßenlaternen u. dergl. können dagegen mehrere angewendet werden.
Diese Luftröhren schützen zugleich die Glascylinder; für Handlaternen können sie
durch horizontale Stäbchen k mit einander verbunden
werden, die mit Halbmuffen h auf den Röhren aufliegen
und leicht entfernt werden können, wenn man zu dem Glascylinder etc. gelangen will. Bei
feststehenden Lampen, welche keinem Luftzug ausgesetzt sind, kann man den
Glascylinder und den Glasträger b weglassen.
Tafeln