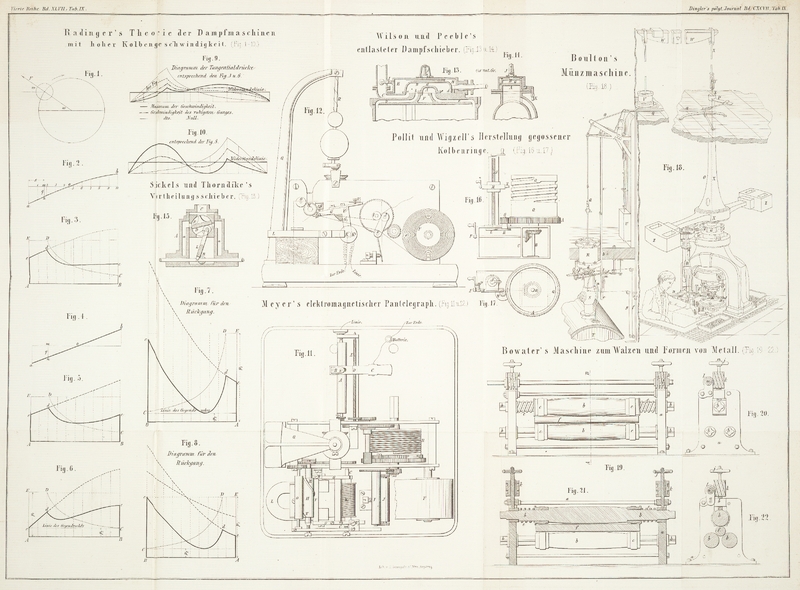| Titel: | Boulton's Münzmaschine. |
| Fundstelle: | Band 197, Jahrgang 1870, Nr. CXX., S. 478 |
| Download: | XML |
CXX.
Boulton's
Münzmaschine.
Nach dem Bulletin de la
Société d'Encouragement, April 1870, S. 214.
Mit einer Abbildung auf Tab. IX.
Boulton's Münzmaschine.
Im weiteren Verlauf des in diesem Bande des polytechn.
Journals S. 193 (erstes Augustheft 1870) bereits erwähnten Artikels über die
Londoner Münzanstalt bespricht E. Dumas die in Figur 18 in
perspectivischer Ansicht dargestellte Münzprägmaschine von Boulton.
Da dieselbe bereits in Prechtl's technologischer
Encyklopädie Bd. X S. 247 (Tafel 215) sehr ausführlich beschrieben und dargestellt
ist, so sey hier nur in Kürze eine Erklärung der Maschine und deren sinnreiche
Ingangsetzung gegeben.
In der Ruhelage dieser Maschine (auch Stoßwerk genannt) stehen Ober- und
Unterstempel am weitesten von einander entfernt. Wird nun der Balancier h, h mit den Gewichten Z
entsprechend gedreht, so wirkt zunächst der Sector A mit
einem Ausschnitt nach einer Spiralcurve auf das obere Ende des zweiarmigen Hebels
B, C, dessen verstellbarer Drehpunkt mit a bezeichnet ist. In Folge dessen wird der Zubringer
D der Münzen zurückgezogen und es gelangt die
ringförmige Zange am rechten Ende genau unter die Füllröhre E, welche der Arbeiter stets mit frischen Platten zu versehen hat. Es
fällt nun eine Münzplatte in die offene Zange des Zubringers D.
Unterdessen ist der Oberstempel vollends niedergegangen und es dreht sich nach
erfolgtem Stoß auf den Unterstempel die Schraube G
zurück. Dabei wird die erwähnte Zange geschlossen, der Zubringer D mit der erfaßten Münzplatte gegen den Mittelpunkt der
Presse geführt und dieselbe auf den Unterstempel aufgelegt, wodurch zugleich das
etwa vorher ausgeprägte Stück in den Münzbehälter gestoßen wird.
Bei dem Niedergehen der Preßschraube (3 wird aber auch vermittelst der Stangen I, I in Verbindung mit den Hebeln J das Aufsteigen des Prägringes K veranlaßt,
welcher die Münzplatte während dem erfolgenden Prägstoß einschließt. Diese Stangen
I, I gehen durch den massiven Theil des Gestelles aufwärts und
sind am oberen Theil der Schraube G an einem sich nicht
mitdrehenden Ringe befestigt. Wird der Oberstempel beim Rückdrehen der Schraube
gehoben, so heben auch die Stangen l, l die äußeren
Enden der Hebel J, während die inneren Hebelarme den
Prägring K niederdrücken, in welchem Augenblick eine
neue Münzplatte vom Zubringer aufgelegt, die bereits geprägte aber weggeschoben
wird. Wenn jedoch die inneren Hebelenden J beim
Niedergang des Oberstempels den Prägring loslassen, so hebt sich derselbe zufolge
einer unter ihm wirkenden dreiarmigen Feder.
Die Schraube G ist mit der Stange X, X in Verbindung, welche von dem Bügel Y an
nur mehr die fortschreitende Bewegung der Prägschraube weiterpflanzt und oben an den
Balancier W, W aufgehängt ist. Der andere Balkenarm
steht mit dem Kolben des oben offenen Cylinders V in
Verbindung, welchen ein Rohr mit dem ausgepumpten Behälter T in Communication setzt und demzufolge den Aufgang der Preßschraube
unterstützt.
Zur Uebertragung der Kraftäußerung einer Dampfmaschine auf das Prägwerk, wird auf
eine recht sinnreiche Weise der Druck der Luft benutzt.Eine Woolf'sche Maschine von 20 Pferdestärken
dient zum Betriebe von 8 Prägwerken. Ursprünglich war die Maschine zur
Wasserförderung für das Münzetablissement bestimmt; doch wurde dieselbe im
Jahre 1851 nach dem Vorschlage des Münz-Ingenieurs Newton zu dem oben angedeuteten Zwecke
verwendet.
Durch die Dampfmaschine wird nämlich eine Luftpumpe in Bewegung gesetzt und die Luft
in dem Cylinder T (ca. 50
Fuß lang und 30 Zoll weit) bedeutend verdünnt.
Oberhalb des Vacuumcylinders T und von einem in diesen
einmündenden Rohre S getragen, ist ein kleiner
verticaler, oben offener Cylinder R angebracht, in
welchem sich ein mit Leder gepackter Kolben befindet. Dieser steht mittelst der
Stangen Q und des Hebels P
mit dem Obertheil O der Prägschraube G in Verbindung.
Zur Ingangsetzung der Münzmaschine spannt der Arbeiter bei derselben die Schnur f dauernd an, wodurch die Feder n angezogen und ein Ventil bei d frei gemacht
wird. Zieht man hierauf die Schnur g an, so öffnet sich
ein Ventil bei j. Die unter dem Kolben im Cylinder R. befindliche atmosphärische Luft dehnt sich in dem
Vacuumbehälter T aus, der äußere Luftdruck treibt den
Kolben nieder und veranlaßt dadurch eine Drehung, resp. das Niedergehen der
Preßschraube G.
Während dieses Kolbenganges schließt ein Knopf bei k an
der Stange c durch den Hebel l das Ventil j. Es gelangt also der untere
Cylinderraum außer Communication mit dem Behälter T.
Zugleich fällt zufolge
eines Knopfes bei m der Hebel e ein und macht das Ventil d frei, durch
welches beim Rückdrehen der Preßschraube Luft unter den Kolben gelangen und
letzterer aufsteigen kann.
Soll die Münzmaschine abgestellt werden, so läßt der Arbeiter die Schnur f nach, so daß die Feder n
das Ventil d offen erhält.
Tafeln