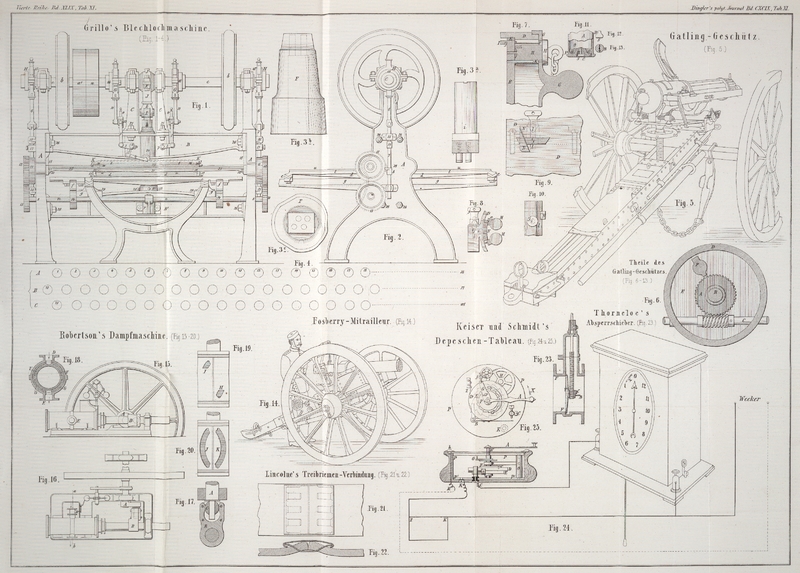| Titel: | Depeschen-Tableau, construirt von Keiser und Schmidt in Berlin. |
| Fundstelle: | Band 199, Jahrgang 1871, Nr. CXXV., S. 464 |
| Download: | XML |
CXXV.
Depeschen-Tableau, construirt von
Keiser und
Schmidt in
Berlin.
Mit Abbildungen auf Tab.
XI.
Keiser und Schmidt's Depeschentableau.
Zwischen den complicirteren Telegraphen-Apparaten welche auf den
Staatstelegraphenlinien den Gedankenaustausch auf meilenweite Entfernungen
vermitteln, und den kleinen einfachen Haustelegraphen-Apparaten welche durch
einfache akustische oder sichtbare Zeichen den Verkehr mit dem Dienstpersonal
erleichtern, machte sich in unserem Geschäftsbetrieb eine Lücke fühlbar, die wir
durch den nachstehend beschriebenen, einfachen und zuverlässigen Apparat ausgefüllt
zu haben glauben.
Während sich die Haustelegraphie auf Mittheilung weniger Zeichen beschränkt und alle
eigentlichen Telegraphen-Apparate, welchen Systemes sie auch seyen, eines
geübten Telegraphisten sowie fortwährender technischer Aufsicht und Regulirung
bedürfen, kann man mit unserem Apparat nicht allein 12 oder 24 vorher bestimmte
Zeichen geben, sondern auch ohne jede Uebung oder Vorkenntniß und ohne daß der
Apparat irgend welcher Regulirung bedarf, kurze Depeschen bequem telegraphiren.
Der in Figur
24 und 25 dargestellte Apparat, von uns Depeschentableau benannt, besteht aus
einem Zeichengeber und einem Zeichenempfänger.
Der Zeichengeber besteht aus zwei durch drei Pfeiler
getrennten Messingplatten P, P und P', P', zwischen denen sich ein Uhrwerk befindet, dessen
Zweck es ist sichere Contacte herzustellen, ohne des Aufziehens zu bedürfen.
Die Kurbel A ist auf der Achse W angeschraubt, wird von einer Feder nach der Richtung des Pfeiles X über eine mit 12 oder 24 Depeschen oder Buchstaben
versehene Scheibe herumgedreht und durch das Hinderniß G
auf- und festgehalten.
Auf der Achse W ist die Rolle F mit dem Sperrrad angeschraubt, so daß beide sich mit der Achse
drehen.
Die erwähnte Uhrfeder ist um die Rolle F gewunden und mit
einem Ende an den Pfeiler O festgeschraubt.
Das Zahnrad D ist mit dem Rade E zu einem Ganzen verbunden und beide sind auf der Achse W drehbar.
Um eine Depesche zu geben, dreht man die Kurbel A in der
Richtung des Pfeiles X von ihrem Ruhepunkt nach dem
Buchstaben oder der
Depesche, welche man geben will; hierdurch wird das durch den in den Windfang,
eingreifenden Hebel G gehemmte Uhrwerk frei, kann sich
aber in der Richtung, in welcher wir die Kurbel drehen, nicht bewegen, weil der
Winkelhebel B das Zahnrad D
festhält, während die Feder sich hierdurch aufzieht; sobald wir indessen die Hand
vom Knopf der Kurbel A entfernen, setzt sich das Rad D und das Uhrwerk in Bewegung, und die Kurbel A läuft auf ihren Ruhepunkt zurück; hierbei gleitet der
Hebel B über die Zähne des Rades E, wird mit jedem Zahn einmal gehoben und erzeugt hierdurch einen sicheren
Contact mit der Säule C, und zwar so oft als man mit der
Kurbelumdrehung Zähne gegriffen hat.
Der Zeichenempfänger unterscheidet sich von dem Kramer'schen Zeigertelegraphen nur dadurch, daß der
Zeiger desselben bei O seinen Ruhepunkt hat, von dem er
sich nur in der Richtung des Pfeiles X entfernen kann
und zwar so oft als der Hebel B des Zeichengebers, der
natürlich mit demselben in leitende Verbindung gebracht seyn muß, Contacte macht; er
springt also genau dieselbe Zahl Felder vor, als der Depeschirende am Zeichengeber
Contacte erzeugte, und wird durch einen leichten Ruck an der Schnur (Fig. 24) nach jeder
Depesche in seine Ruhestellung bei O zurück
versetzt.
Um auf einfache Weise einen Wecker einzuschalten, wird der Messingring h mit dem Draht R in
leitende Verbindung gebracht und nach dem Wecker geführt. Da die Kurbel A mit dem Körper des Gebers, also mit einem Pol der
Batterie verbunden ist, so hat man nur nöthig diese Kurbel während des Depeschirens
auf den Ring h zu drücken, um den Wecker in Thätigkeit
zu setzen.
Die zum Betrieb des Apparates incl. Wecker nöthige
Batterie besteht aus vier Leclanché'schen
Elementen (man s. Preisverzeichniß von Keiser und Schmidt, I. Theil Seite 12).
Der Preis des Apparates beträgt excl. Wecker
mit 12 Feldern für Zeichengeber und Empfänger
25 Thlr.
deßgleichen mit 24 Feldern
35 Thlr.
1 Wecker kostet
4 Thlr. 20 Sgr.
Der Apparat hat seine Brauchbarkeit bereits an mehreren Orten praktisch bewährt (drei
dieser Apparate sind z.B. im Wolf'schen
Telegraphen-Bureau seit mehreren Monaten in ununterbrochener Thätigkeit);
größeren Fabriken, Feuerwehren, Bergwerken, Schießständen etc. dürfte derselbe eine
sehr empfehlenswerthe Verkehrserleichterung bieten.
Berlin, 17. Februar 1871.
Tafeln