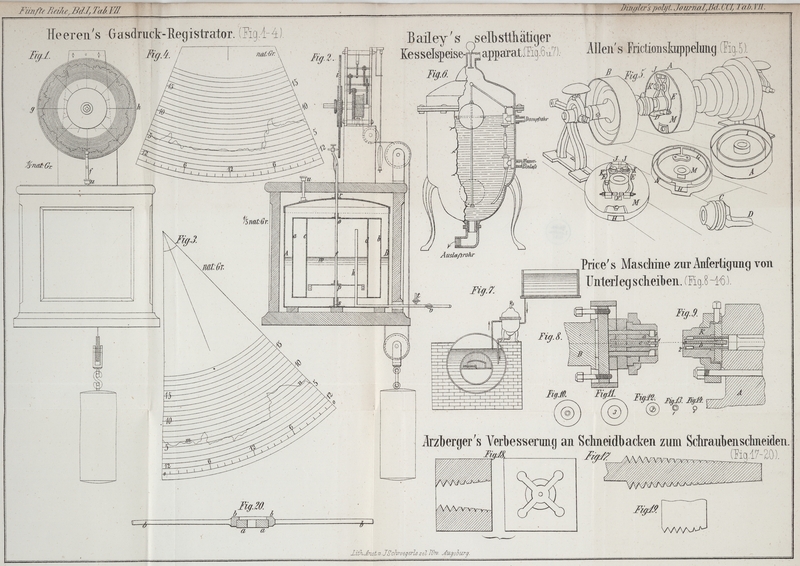| Titel: | Allen's Frictionskuppelung. |
| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. LXXVI., S. 285 |
| Download: | XML |
LXXVI.
Allen's Frictionskuppelung.
Nach dem Scientific American, Juni 1871, S.
390.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Allen's Frictionskuppelung.
Edwin F. Allen in Providence (Amerika) ließ sich die in
Fig. 5 in
der Ansicht und in verschiedenen Details abgebildete Frictionskuppelung für
Riemenscheiben etc. patentiren.
A und B bezeichnen zwei
Scheiben, welche durch Verschiebung des Stellringes C
abwechselnd mit der Welle in Verbindung gesetzt werden. In diesem Falle sind an dem
Ring C nach beiden Seiten hin keilförmige Ansätze D vorhanden.
Wie in der Detailansicht — rechts in der Abbildung — zu ersehen ist,
geht concentrisch zum Spurkranz der Scheibe A oder B ein Ring I, um welchen der
eigentliche Kuppelungstheil M — weiter links von
beiden Seiten dargestellt — gelegt wird. Derselbe besteht aus einer Platte
mit einem vorstehenden Kranz N am Umfang; an diesem ist
bei H ein gegenüber der Verbindungsstelle gespaltener,
elastischer Ring G befestigt, welcher um den an der
Scheibe A angegossenen Kranz I lose oder fest angelegt werden kann. Im letzteren Falle muß die Scheibe
die Umdrehungen der Welle mitmachen, auf welcher der Kuppelungstheil M aufgekeilt oder mittelst Schrauben befestigt ist.
Um den federnden Ring G anzuziehen, sind die beiden Enden
desselben mit den Ansätzen J, J versehen, welche durch
die durchbrochene Scheibe M auf der anderen Seite
hervortreten und mittelst der gekrümmten Hebel E, E genähert werden können.
Diese Hebel sind bei K drehbar angeordnet und an ihrem
unteren Ende befinden sich Stellschrauben F, zwischen
welche der Keil D des Gleitringes C eingeschoben werden kann.
Der Gleitring C sitzt mittelst Keilnuth auf der Welle und
wird vom Arbeiter mit Hülfe eines Stellhebels nach links oder rechts gerückt, wenn
die eine oder die andere Scheibe (A oder B) gekuppelt werden soll. In der Mittellage des
Stellringes C laufen beide Scheiben leer.
Tafeln