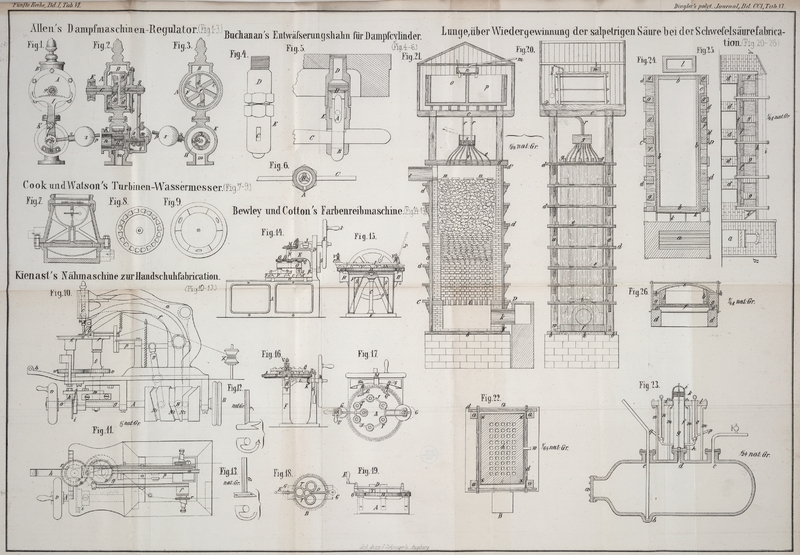| Titel: | Neue Nähmaschine zur Handschuhfabrication. |
| Fundstelle: | Band 201, Jahrgang 1871, Nr. LXXIX., S. 291 |
| Download: | XML |
LXXIX.
Neue Nähmaschine zur
Handschuhfabrication.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Kienast's Nähmaschine zur Handschuhfabrication.
Diese Maschine stellt die sogenannte überwendige Naht her,
und zwar mit einem Faden sowohl wie mit zwei Fäden; sie ist also mit anderen Worten eine einfädige und zweifädige
Nähmaschine. Für Greifer oder Schiffchen hat sie andere, und zwar rotirende
Mechanismen, dagegen arbeitet sie mit gewöhnlicher Nähmaschinen-Nadel. In der
Praxis eignet sie sich besonders gut zum Nähen von
Handschuhen, und wird hierzu gewiß eine bis jetzt bestehende Lücke
ausfüllen.
Von den beigegebenen Darstellungen der Maschine (ohne Gestell) ist Fig. 11 ein Grundriß und
Fig. 10
ein Aufriß; die in wirklicher Größe gezeichneten Figuren 12 und 13 stellen
Mechanismen dar, welche bei anderen Maschinen durch Greifer und Schiffchen vertreten
werden.
Die unter dem (nicht gezeichneten) Tische befindliche Welle A ist die Hauptbetriebswelle der Maschine, und wird (wie gewöhnlich) durch
Trittbret mittelst der Schnurrolle B von dem Nähenden
getrieben, kann aber auch, beim Anlassen der Maschine, durch das Handrad v in Umdrehung gesetzt werden.
Für die Stoff-Transportirung befindet sich auf der genannten Welle A zunächst das Rad i;
dasselbe setzt ruckweise das Rad o und dieses wieder das
Rad g in Bewegung; g, dessen
oberes Ende den metallenen Teller f trägt, sitzt auf
einer Welle. Die Welle dieses Tellers treibt mittelst der Räder v und v′ einen eben
solchen zweiten Teller f1, dessen obere Kante sich gegen den Rand des Tellers f legt und durch eine Feder h gegen diesen gedrückt wird. Zwischen die Ränder der erwähnten Teller f und f1 wird der zu nähende Stoff gebracht und der erwähnte Druck mit
dem linken Fuße ausgeübt, indem von h eine Stange nach
einem Fußtritte angeordnet ist. Uebrigens kann durch Auswechselung des Rades o auch die Geschwindigkeit der Transportscheiben f und f1, d. h. die Länge des Stiches geändert werden, was eine und
dieselbe Maschine für die verschiedensten Arbeiten brauchbar macht.
Die anderen Mechanismen werden mittelst des Theiles H der
Welle A bewegt, welcher verstärkt und mit drei Nuthen
versehen, die Hebel bewegt. — Die Nuth Nr. 1 bewegt zunächst, mittelst v und p, geradlinig hin und
her, die horizontal liegende Nähnadel, deren Nuth nach unten gestellt ist. Die Nuth
Nr. 3 bewegt den Hebel a, welcher bei seiner Bewegung
mittelst einer Spiralnuth den Cylinder x dreht, mit dem
entweder der Körper Fig. 12 oder Fig. 13 verbunden wird.
Jeden der letzt erwähnten Körper wollen wir Bogenfänger
nennen. Die Nuth Nr. 2 endlich bewegt den Hebel f, der
am Ende mit dem Körper b verbunden ist, welcher
auf- und abwärts bewegt wird. Dieser Körper werde Geradfänger genannt, und es sey noch bemerkt, daß sowohl der Geradfänger
wie die Bogenfänger sich in senkrechter Richtung verstellen lassen.
Die Nahtbildung mit einem Faden geschieht in folgender
Weise: Es wird dazu der Bogenfänger c (Fig. 12) in x eingesetzt. Man leitet dazu den Faden von der
Fadenrolle X durch die Spannungsscheibe r (Fig. 11) über die Spirale
nach dem Nadelhalter d; man fädelt dann den Faden von
unten nach oben ein. Nun drückt man auf die Feder h,
öffnet dadurch die
Transportteller und legt den zu nähenden Stoff dazwischen. Jetzt kann die Maschine
durch das Handrad v in Bewegung gesetzt werden (dasselbe
ist hierzu von links nach rechts zu drehen), und es wird dabei die Nadel den Stoff
durchstechen. Bei etwa 4 Millimeter Rückgang bildet der Faden eine hochstehende
Schleife. In diese greift mit der unteren Gabel der Bogenfänger c, Fig. 12, welcher sich
kreisförmig bewegt, und legt die Fadenschleife über die Kante des Stoffes. Nun kommt
der Geradfänger b und drückt diese Fadenschleife so tief
nieder, daß die Nadel in diese Schleife einsticht, wodurch die Kette hergestellt
ist. Durch Fortsetzung dieser Operation wird eine schöne überwendige Naht
gebildet.
Die Nahtbildung mit zwei Fäden geschieht in folgender
Weise: Dazu wird zunächst der Bogenfänger a (Fig. 13) in
x eingesetzt. Derselbe hat am hinteren und vorderen
Ende ein Loch, und nach Außen eine Fadenrinne. Der zweite, in diese Löcher kommende
Faden wird von hinten nach vorn in diesen Bogenfänger eingezogen und beim Nähen nun
ebenso wie beim einfachen Faden verfahren. Der gegenwärtige Bogenfänger a, welcher den zweiten Faden enthält, greift ebenfalls
in die Schleife, welche sich bei etwa 4 Millimeter Rückgang der Nadel am Nadelfaden
bildet; dadurch verkettet sich der Fängerfaden mit dem Nadelfaden; der Bogenfänger
a trägt seinen Faden nun über die Kante des Stoffes
und vabei drückt, wie früher, der gerade Fänger b den
Nadelfaden so tief, daß die Nadel in die Schleife sticht und die Verschlingung
fertig ist. Diese Naht wird etwas stärker wie die vorige, was für Handschuhe sich
nicht, wohl aber für Strumpfwaare empfehlen wird.
Bei Handnäherei kann ein Mädchen in 12 Stunden 2 Paar, beim Nähen mit dieser Maschine
in derselben Zeit 12 Paar Handschuhe nähen, so daß die Leistungen derselben als
vorzügliche zu betrachten sind.
Erfinder dieser Maschine ist der Maschinenfabrikant Kienast in Berlin, welchem sie auch in mehreren Staaten patentirt
wurde.
Dr. Robert Schmidtin Berlin.
Tafeln