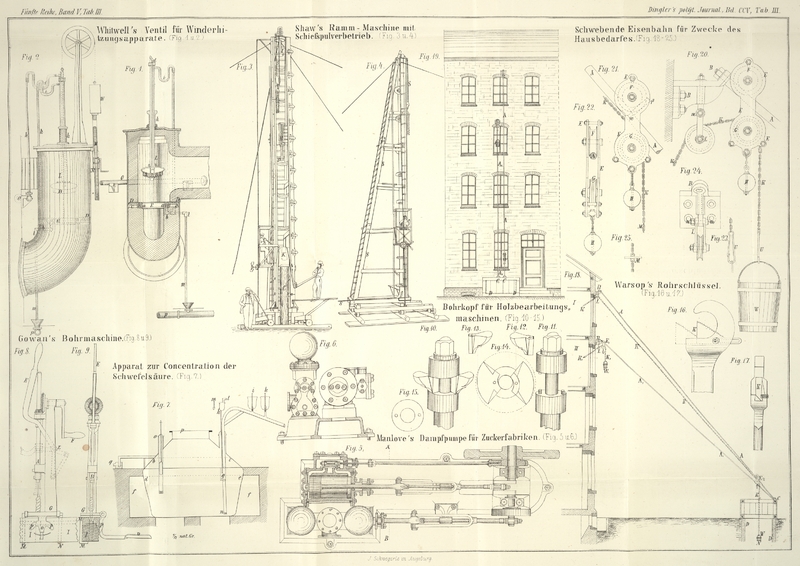| Titel: | Whitwell's Ventil für Winderhitzungsapparate. |
| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. XXXVII., S. 98 |
| Download: | XML |
XXXVII.
Whitwell's Ventil für
Winderhitzungsapparate.
Nach Engineering, Juni
1872, S. 388.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Whitwell's Ventil für Winderhitzungsapparate.
Die Ventile, welche bei den neuesten Winderhitzungsapparaten für Hohöfen der bis
700° Celsius erhitzten Gebläseluft ausgesetzt sind, bedürfen, um überhaupt
verwendbar und dauerhaft erhalten zu werden, continuirlicher
Wasserkühlung. Thomas Whitwell in Stockton
on-Tees hat bei seinen ausgezeichneten WinderhitzungsapparatenBeschrieben im polytechn. Journal, 1870, Bd. CXCVII S. 315. nach verschiedenen Versuchen die in Figur 1 und 2 dargestellte
Ventilconstruction in Anwendung gebracht.
Der Ventilkasten ist aus Blech genietet und trägt den Ventilsitz E in einen Ring D eingepaßt,
welcher auf die abgedrehte Fläche des Winkelringes C
dicht aufgesetzt ist. Die Theile C und D sind durch feuerfestes Material, welches das ganze
Gehäuse inwendig auskleidet, geschützt; der Ventilsitz E
selbst aber ist durch Wasser gekühlt, welches ununterbrochen durch das in E eingegossene Röhrchen a
rinnt. Ebenso wird in das Ventil C – aus Gußeisen
hohl gegossen und an der Sitzfläche abgedreht – durch das in der Hohlspindel
L befindliche Röhrchen kühles Wasser eingeleitet,
welches alsdann in dem ringförmigen Raum zwischen Spindel und Röhrchen aufsteigt,
durch das Rohr k nach dem Ventilsitz E beziehentlich dem Röhrchen a und endlich von da durch m nach dem
Abzugsrohr p geführt wird.
Die Speisung mit frischem Wasser erfolgt aus der Leitung o durch die Röhre h. Die Röhren h und k sind fest, dagegen
die Verbindungsstücke f und i beweglich, um das Auf- und Abwärtsgehen der Ventilspindel L zu gestatten. Die Stellung des Ventiles läßt sich
mittelst Zahnstange und Getriebe N leicht
bewerkstelligen, da das Gegengewicht W das Ventil
theilweise ausbalancirt.
Zum ferneren Schutz des Ventiles an der dem heißen Winde zugekehrten Seite kann man
dieselbe noch mit einer Decke von feuerfestem Material versehen, was jedoch im
Allgemeinen bei gehörigem Wasserwechsel überflüssig ist.
Tafeln