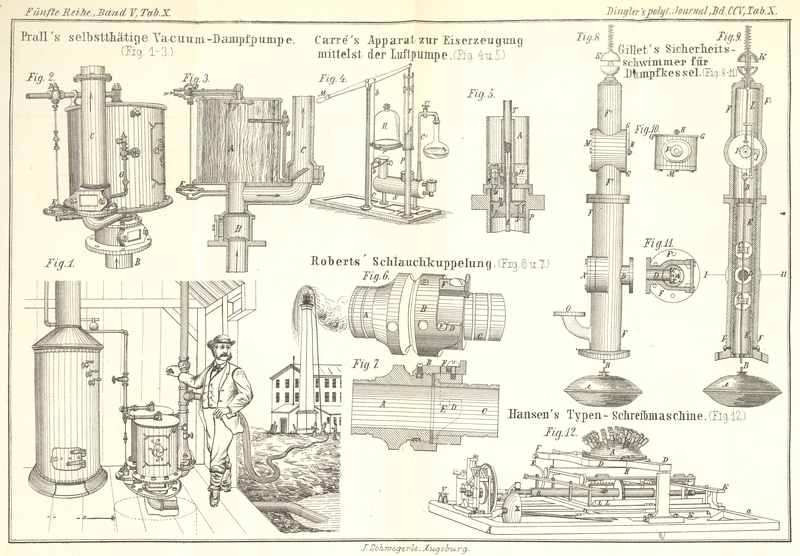| Titel: | Ed. Carré's Apparat zur Eiserzeugung mittelst der Luftpumpe. |
| Fundstelle: | Band 205, Jahrgang 1872, Nr. CI., S. 417 |
| Download: | XML |
CI.
Ed. Carré's
Apparat zur Eiserzeugung mittelst der Luftpumpe.
Nach dem Bulletin de la
Société d'Encouragement, August 1872, S. 462.
Mit Abbildungen auf Tab.
X.
Carrés' Apparat zur Eiserzeugung mittelst der
Luftpumpe.
Im Jahrgang 1867 des polytechn. Journals, Bd. CLXXXV S. 77, theilten wir die
Beschreibung einer auf dem bekannten Leslie'schen
Versuche beruhenden Eisbereitungsmethode von Ed. Carré mit, bei welcher durch Evacuirung mittelst einer für diesen
Zweck eigens construirten Luftpumpe und unter gleichzeitiger Mitwirkung
concentrirter Schwefelsäure als hygroskopischer Substanz eine rasche Eisbildung
erzielt wird. Wir sind
nun im Stande, jene Mittheilung durch die nähere Beschreibung des Apparates mit
Hülfe der Abbildungen Fig. 4 und 5 zu ergänzen, welche dem
Cours de Physique de MM. Ch.
Brisse
et Ch.
André (Paris
, Dunod
éditeur) entlehnt sind.
Fig. 4 ist
eine perspectivische Ansicht der Maschine mit Hinzufügung des bei gewöhnlichen
Luftpumpen gebräuchlichen Tellers und Recipienten; letzterer Zusatz gilt jedoch nur,
wenn die Maschine für physikalische Cabinete bestimmt ist. Fig. 5 stellt den
Pumpenstiefel nebst Kolben und Ventilen im Verticaldurchschnitte dar. P ist der Stiefel, p der
Kolben, T die Kolbenstange, M der zur Auf- und Niederbewegung der letzteren dienende Hebel. S ist ein kleiner Kessel, aus einer Legirung von Blei
und Antimon, welcher die concentrirte Schwefelsäure aufnimmt. Eine in demselben
angebrachte Rührvorrichtung wird durch Vermittelung der Stange b vom Hebel aus in Bewegung gesetzt. Das Ende dieses
Kessels S steht durch die Röhre C mit der unteren Basis des Pumpenstiefels, der obere Theil durch die
Röhre C' mit dem zu evacuirenden Recipienten in
Verbindung.
Bei der in Fig.
4 dargestellten Anordnung handelt es sich eigentlich um die Wiederholung
des bekannten Leslie'schen Versuches in größerem
Maaßstabe, nämlich um den Versuch, das Wasser in einer Flasche gefrieren zu machen,
eine Operation welche keiner näheren Erläuterung bedarf. Läßt man die Flasche weg
und verbindet das Ende der Röhre C' mit dem am Teller
des Recipienten R angebrachten Hahn r durch ein Metallrohr, so kann man ein trockenes Vacuum
im Recipienten erzeugen.
Folgendes sind die Details der Pumpe. Die Kolbenstange T
(Fig. 5)
bildet an sich eine Röhre, worin die messingene Stange t
gleitet, welche das untere Ventil des Pumpenstiefels trägt. Das obere gespaltene
Ende der Stange t drückt federnd gegen die innere Wand
der Stange T. Da das Ventil s' des Kolbens p ein wenig über die untere
Basis des letzteren herausragt, so wird es durch das Spiel der Maschine selbst
gehoben, wenn der Kolben an dem unteren Ende seines Hubes angelangt ist.
Der obere Theil des Stiefels ist durch eine Metallplatte c, durch deren Mitte die Kolbenstange T tritt,
hermetisch geschlossen. Diese Platte ist mit einem nach oben sich öffnenden Ventil
S ausgestattet. Wenn der Kolben am oberen Ende
seines Hubes angekommen ist, so stößt er gegen das untere in das Innere des Stiefels
etwas hineinragende Ende des Ventiles S und hebt es; die
in dem Stiefel enthaltene Luft entweicht und gelangt durch die Löcher o zunächst in eine im Behälter A befindliche Oelschicht H und von da in's Freie. Wenn dagegen das
Ventil S sich schlicht, so ist die äußere Luft durch die
Oelschicht verhindert in den Pumpenstiefel zu dringen, bis zu welchem Grade der
Luftverdünnung man auch gelangt seyn mag.
Tafeln