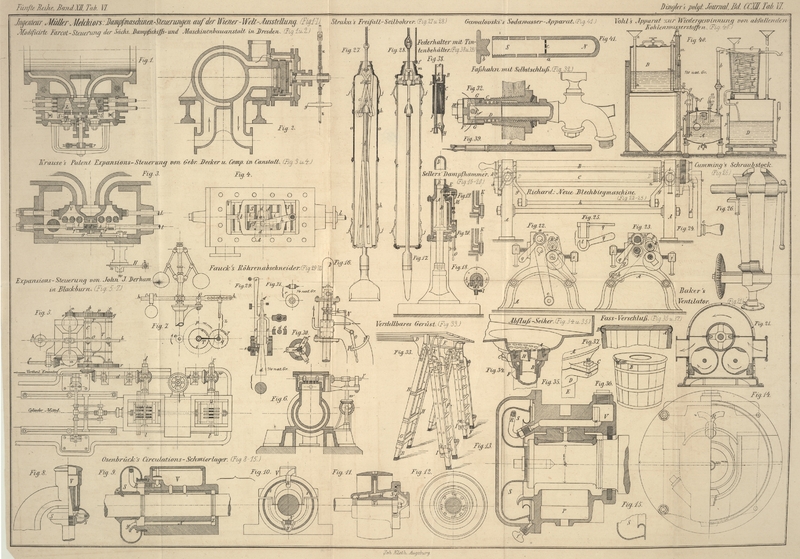| Titel: | Circulations-Schmiervorrichtung für Lager und Lagerbüchsen rasch rotirender Wellen; von August Osenbrück in Hemelingen bei Bremen. |
| Autor: | Z. |
| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. LXI., S. 379 |
| Download: | XML |
LXI.
Circulations-Schmiervorrichtung für Lager
und Lagerbüchsen rasch rotirender Wellen; von August Osenbrück in Hemelingen bei Bremen.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Osenbrück's Circulations Schmiervorrichtung.
Um bei rasch rotirenden Wellen und Zapfen, wie für Kreissägen, Holzhobelmaschinen,
Ventilatoren, Bandsägen, Centrifugalmaschinen, Eisenbahnwagenachsen, ferner bei
losen Riemenscheiben u. dergl. eine verläßliche, ökonomische Schmierung zu erzielen,
hat Osenbrück die sogenannte
Circular-Schmiervorrichtung entworfen (und in verschiedenen Staaten
patentirt), bei welcher durch die Umdrehung der Welle eine continuirliche Bewegung
des Schmiermateriales entlang der Lagerfläche nach einem Auffanggefäße und von da
zurück nach dem Oelreservoir und wieder über die Lauffläche u.s.f. hervorgerufen
wird.
Zu diesem Behufe wird, wie man dies leicht aus den beigegebenen Abbildungen in Figur 8 bis
15
entnehmen kann, für jedes zu schmierende Lager auf der betreffenden Welle eine
metallene Auffangschale S angebracht, welche genau
concentrisch mit der Welle rotirt. An dem dieser Schale zugekehrten Ende des festen
Lagergehäuses ist ein messingenes oder eisernes Rohr R
angebracht, welches in die Schale bis nahe zum inneren größten Umfange derselben
hineinragt und so gekrümmt ist, daß seine äußere Oeffnung der Drehungsrichtung der
Welle entgegensteht.
Enthält nun die Schale S flüssiges Schmiermaterial, so
verbreitet sich dieses bei der raschen Umdrehung ringförmig auf dem größten inneren
Durchmesser der Schale und wird, da es an der Drehung Theil nimmt, von dem
unbeweglichen Rohre R aufgefangen und mit einer von der
Umfangsgeschwindigkeit der Schale abhängigen Beschleunigung in das Schmierreservoir
V des Lagers zurückgeführt. Von hier aus tropft das
Oel, nachdem es die Lagerfläche schmierend passirt hat, zur Schale S zurück, um neuerdings den angedeuteten Weg zu
durchlaufen. Auf diese Weise wird, wie leicht einzusehen, das Schmiermaterial auf
das äußerste ausgenützt.
Die Figuren
8–9 und 10–11 und 12–13 bis 15 stellen
beziehungsweise die Osenbrück'sche
Circulations-Schmiervorrichtung an den Lagern einer stehenden Welle, einer
horizontalen Welle, einer losen Riemenscheibe und einer Eisenbahnwagenachse dar;
gleichen Zwecken dienende Theile sind mit denselben Buchstaben bezeichnet.
Obere Lagerbüchse einer stehenden Welle oder Spindel
(Figur 8).
Die Auffangschale S – welche der Constructeur mit
dem Namen „Centrifugalschale“ bezeichnet, da das Schmieröl
vermöge der durch die Rotation hervorgerufenen Centrifugalkraft weitergetrieben wird
– ist unterhalb des conischen Zapfens auf die Spindel aufgeschraubt. Ihre
obere Oeffnung umfaßt willig den Hals der oberen Lagerhülse. In diese feststehende
Hülse ist das Rohr R eingeschraubt und führt eine damit
communicirende Bohrung nach der Schmierkammer V, welche
durch eine Kapselverschraubung geschlossen ist.
Getheiltes Lager für eine horizontale Welle (Figur 9 und
10). In
den Lagerdeckel ist das Auffangrohr R eingeschraubt und
zwar unter eine Uebersattlung s des Deckels, welche
außen concentrisch mit der Welle abgedreht ist. In der unteren Hälfte läuft die
Uebersattlung in eine Rinne y aus, welche in die Schale
S hineinragt. Ueber der Austrittsöffnung des Rohres
R ist an den Lagerdeckel eine Blechkappe angebracht,
um zu verhindern, daß beim Beginne der Drehung – wenn das gesammte Oel aus
der Schale S in die Kammer V
getrieben wird – das Oel gegen den Lagerdeckel spritzt. Das aus der Kammer
V nach dem der Schale S
entgegengesetzten Lagerende Z – ablaufende
Schmieröl wird durch den Canal N über die Rinne y wieder nach der Centrifugalschale
S zurückgeführt. Die Einkerbungen auf beiden Seiten des
gelagerten Wellenhalses sind ein bekanntes Mittel, um das Vergleichen von Oel nach
außen zu verhüten. Als Staubverschluß dienen die beiden Lederringhälften, welche in
einer concentrischen Nuth oberhalb der Uebersattlung s
eingezwängt sind und die Schale S berühren.
Lagerung einer losen Riemenscheibe (Figur 11 und 12). In die
Achse ist ein centrales Loch bis etwas über das Mittel der Riemenscheibe eingebohrt.
In das äußere Ende dieser Bohrung ist das Rohr R
eingeschraubt, das andere führt durch eine radiale Bohrung in die Nuth V. Die Schale S ist hier
kegelförmig angeordnet und durch einen Ring T, welcher
die warm eingezogene Laufbüchse (aus Gußeisen oder Rothguß) festhält, in zwei
Hälften getheilt. Die Communication der vorderen und hinteren Schalen-Kammer
wird durch Löcher c in dem Ringe T vermittelt. Die Wirkungsweise dieser Disposition erklärt sich wie die
obigen von selbst. Während bei den gewöhnlichen losen Riemenscheiben das Oel um so
schneller abgeschleudert wird, je rascher sie rotiren, schmiert sich diese Scheibe
alsdann um so energischer.Nach Mittheilung des Erfinders machte eine lose Riemenscheibe, welche 1080
Touren pro Minute zurücklegte und deren
Schenkeldurchmesser 1 1/2 Zoll engl. (38 Millim.) betrug, bei einer Füllung
von 1/17 Pfd. Oel 64 Millionen Umdrehungen, ohne daß das mindeste Warmlaufen
vorkam. Als die Scheibe zur Untersuchung abgenommen wurde, fand sich noch
genügend Oel von durchaus reiner, wenn auch etwas ranziger Beschaffenheit
vor, um wenigstens noch weitere 5 bis 6 Millionen Touren machen zu
können.
Achsenlager für Eisenbahnwagen (Fig. 13 bis 15). Dieses
Lager ist für die bekannte Polsterschmierung von unten und für die neue
Circulations-Schmierung von oben eingerichtet. Bei Wegfall der ersteren,
vereinfacht sich die Lagerconstruction wesentlich. Die Schmierschale S wird aus Kupfer- oder Messingblech (Figur 13),
billiger und ebenso dauerhafter aber ganz aus getempertem (adoucirtem) Gußeisen
hergestellt (Figur
15). Dieselbe ist in dem Schenkelkopf concentrisch eingedreht und mittels
Schraube an denselben befestigt. R, S und V bezeichnen die bekannten Theile. Um der Luft aus der
Oelkammer V einen Ausweg zu verschaffen, führt das
Bohrloch x aus derselben durch den Lagerdeckel in die
darunter liegende Lagerkammer. Die Füllung mit Oel geschieht seitlich durch die
Polsterschmierkammer P, aus welcher das Schmiermittel
durch zwei oben in dieser Kammer befindliche Schlitzlöcher in das Unterlager und von
diesem in die Schmierschale S eintritt. Vor Beginn der
Füllung des Lagers entfernt man die Flügelschraube f
(Figur
13) und erkennt an dem Hervortreten von Oel aus diesem Schraubenloche die genügende
Füllung. Da die Eisenbahnfahrzeuge vorwärts und rückwärts laufen, so ist das
Auffangrohr R gabelförmig gestaltet, daher für beide
Drehungsrichtungen der Centrifugalschale S gleich
wirksam.Wegen Uebertragung von Patenten wende man sich an den Maschinenfabrikant
August Osenbrück in Hemelingen bei Bremen.
Z.
Tafeln