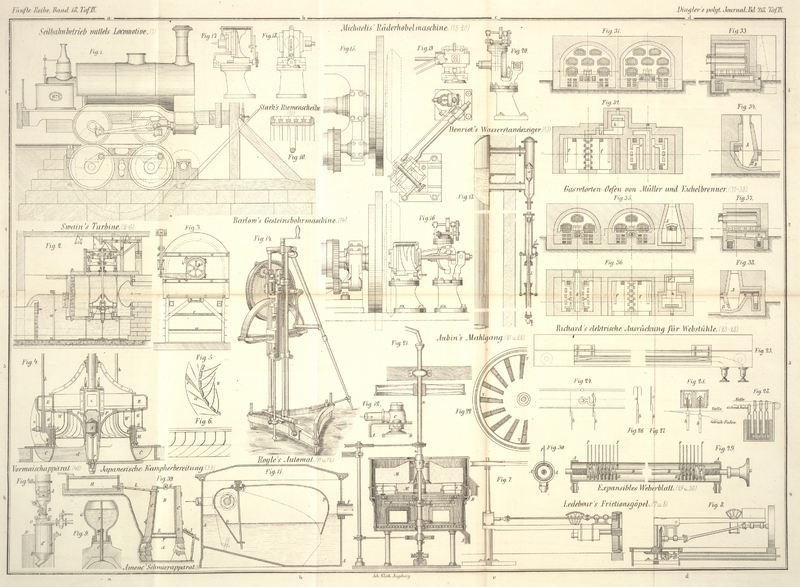| Titel: | Michaelis' Räderhobelmaschine; mitgetheilt von Professor H. Falcke. |
| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 396 |
| Download: | XML |
Michaelis'
Räderhobelmaschine; mitgetheilt von Professor H. Falcke.
Mit Abbildungen auf Taf.
IX [b.c/1].
Falcke, über Michaelis' Räderhobelmaschine.
In der Werkstatt des Chemnitzer Maschinenbauvereins (vorm. Schellenberg), welche die Zahnräderfabrikation als Specialbranche in
größerem Maßstabe betreibt, werden jetzt Räderhobelmaschinen ausgeführt, auf welchen
sowohl Stirn- als Diagonalräderzähne gleich richtig hergestellt werden
können. Diese Maschinen, vom jetzigen Mitdirector der Fabrik, Hrn. Michaelis, construirt und derselben patentirt, haben das
Eigenthümliche, daß sie sich mit Vortheil an einer gewöhnlichen Plandrehbank
anbringen lassen, daß demnach das eben ausgebohrte und abgedrehte Rad ohne weiteres
Umspannen sogleich hinsichtlich seiner Umzahnung der ferneren Bearbeitung
unterliegen kann.
Dieses Umstandes wegen wird die Michaelis'sche Maschine (welche aber natürlich auch
mit besonderm Gestell als bloße Räderhobelmaschine ausgeführt werden kann) mancher
kleineren Werkstatt sehr willkommen sein, die nicht in der Lage ist, fortwährend
eine theure Specialmaschine zu beschäftigen.
Soll nun der Räderhobelapparat an einer Plandrehbank Verwendung finden, so ist
zunächst an deren Spindel (am bequemsten am hinteren oder Gegenspitzenende) ein
Eintheilungsrad anzubringen, welches nach geschehener Bearbeitung eines Zahnes durch
die gewöhnlichen Mittel, d.h. eine Schraube, die geeigneten Wechselräder und eine
Kurbel mit Sperrvorrichtung, den einer gewünschten Zähnezahl entsprechenden
Bruchtheil einer Umdrehung fortgedreht werden kann und diese Drehung auf die
Spindel, beziehentlich das zu schneidende Rad überträgt.
Was den eigentlichen Hobelapparat anlangt, so ist zunächst daran zu erinnern, daß bei
den gewöhnlichen Plandrehbänken, die blos einen Spindelstock mit Planscheibe, aber
kein eigentliches Bett besitzen, meistens vor dem Spindelstock eine Bodenplatte
liegt, auf welcher sich kleine Ständer verschieben und feststellen lassen, als
Untersatz für die darauf in passender Höhe aufzustellenden Drehstahlsupports. Die
Ständer haben oben einen horizontalen runden Teller, damit der mit einem ähnlichen
Teller versehene Support sich darauf um eine verticale Achse drehen läßt.
Solche Ständer sind für den Räderhobelapparat zwei erforderlich, einer für den
Betriebsmechanismus, der andere für den hin und her (bei Stirnrädern horizontal, bei
conischen Rädern verschiedenartig geneigt) zu bewegenden Schneidstahlsupport. Diese
beide Mechanismen sind ebenfalls wie die gewöhnlichen Drehstahlsupports mittels
solcher Teller um verticale Achsen drehbar auf die Ständer aufgesetzt, die Teller
drehen sich aber in einer nachstellbaren Schwalbenschwanzführung, da sie (wenigstens
beim Schneiden conischer Räder) nicht hochgeschraubt werden und kein Seitenspiel
haben dürfen. Das Gestell des Betriebsmechanismus enthält das Lager für eine
horizontale Welle mit Kurbelscheibe, die vermöge der Verstellbarkeit des
Kurbelzapfens einen beliebig großen Hub herzustellen erlaubt, und welche durch
conische Räder von einer stehenden Welle betrieben wird, die ihrerseits ihre
Bewegung durch andere Räder von einer liegenden, mit Treibriemenscheibe versehenen
empfängt. Das Lager der letzteren Welle ist abermals mit einem conachsial zur
stehenden Welle drehbaren Teller oben auf dem Gestell aufgesetzt, damit bei
beliebiger Stellung des ganzen Betriebsständers die Treibriemenscheibe die geeignete
Stellung gegen den von einer Transmission herkommenden Riemen einnehmen kann.
Außerdem besitzt das Gestell des Betriebsmechanismus noch einen emporsteigenden
Seitenarm, der oben in einer Gabel ausläuft, um dort die beiden (ihrer Richtung nach
in die Verlängerung der Kurbelwellenachse fallenden) Seitenzapfen einer cylindrisch
gebohrten Hülse aufzunehmen.
Bei dem anderen Theil des Mechanismus finden wir zuerst über dem auf dem Ständer
liegenden Drehteller eine horizontale Prismenführung (Support) angebracht, auf
welcher durch eine mittels Schaltwerk zu bewegende Schraube eine Schiebeplatte sich
verstellen läßt. An letztere ist eine aufrechte Winkelplatte angegossen, ebenfalls
mit einer oben senkrechten Prismenführung versehen. Die auf letzterer bewegliche
Schiebeplatte sucht durch ihr Gewicht sich stets zu senken, und wird hieran dadurch
verhindert, daß sie mit der vorragenden Kante eines daran angebrachten Fußes sich
von oben gegen die auf der horizontalen Prismenführung aufgestellte Zahnschablone
stemmt. Wird demnach die erste Schiebeplatte auf ihrer Führung verschoben, so muß
die zweite entsprechend der schrägen oder gekrümmten Form der Zahnschablone eine
senkrechte Bewegung annehmen.
An die senkrechte Schiebeplatte legt sich nun eine anderweite Platte an; diese ist
beziehentlich durch einen Drehteller mit jener so vereinigt, daß sie daran sich um
eine horizontale Achse verdrehen kann; es ist außerdem eine Stange daran befestigt,
deren cylindrisches Ende in die bewegliche Hülse am Betriebsmechanismus eingesteckt
ist, und es ist auf der freiliegenden verticalen Fläche dieser Platte eine
(Horizontalbewegung gestaltende) Prismenführung vorhanden, deren Schieber die
Einspannvorrichtung für den Schneidstahl und den Zapfen zur Aufnahme der von der
Kurbelscheibe herkommenden Kurbelstange enthält. Die Kurbelstange besteht aus zwei
parallelen Rundeisenstangen mit Schraubengewinden, auf denen sich der Stangenkopf
oder das Kurbelwalzenlager zwischen Muttern festklemmen läßt, damit die
Stangenlänge. beliebig verändert werden kann. Beide Stangenzapfen sind übrigens als
Kugelzapfen ausgeführt.
Aus dem Gesagten läßt sich nun leicht schließen, daß der Schlitten mit dem
Schneidstahl durch die Kurbelscheibe die Hin- und Hergangsbewegung zuertheilt
erhält, und ist nur noch zu erwähnen, daß dieser Schlitten am jedesmaligen Ende
seines Weges mit einem der Hublänge entsprechend stellbaren Knopf an einen Hebel
anstößt und durch diesen den Schaltwerkshebel der Schraube der zuerst erwähnten
horizontalen Prismenführung bewegt.
In Bezug auf die Anordnung und Aufstellung des ganzen Apparates ist noch zu bemerken,
daß der Ständer des Betriebsmechanismus beim Schneiden conischer Räder so stehen
muß, daß seine verticale Drehachse (d.h. die des Tellers) mit der Kegelspitze des
Rades zusammenfällt; daß ferner die geometrische Anordnung so sein muß, daß die von
der Schneidstahlspitze beschriebene Linie in ihrer Verlängerung durch die Kegelspitze, beziehentlich
durch die Ständerachse des Betriebsmechanismus geht und parallel zur Längenachsen
der beweglichen Hülse läuft. Bei der Aufstellung wird übrigens darauf zu achten
sein, daß die Richtungslinie der untersten Parallelführung in die Richtung der Seite
des sogen. Ergänzungskegels, d.h. senkrecht zur Seite des Radkegels zu stehen
kommt.
Man kann nun immer sämmtliche Zähne nach einander blos auf einer Seite hobeln und muß
dann eine entgegengesetzte Schablone einsetzen, um auch die sämmtlichen anderen
Zahnseiten nach einander zu vollenden. Ist aber der Apparat einmal angestellt, so
arbeitet er die Zähne auch ganz richtig derart, daß alle Linien nach der Kegelspitze
zulaufen, da nach dem Zusammenhang der Theile der Schneidmechanismus sich bei jedem
neuen Schnitt etwas um die senkrechte Achse des Betriebsständers, also um die
Kegelspitze dreht, und beim Heben und Senken des Schneidstahles dessen Führung durch
die Hülse in der Stange gezwungen wird, sich um eine horizontale, durch die
Kegelspitze gehende Achse zu drehen.
Beim Hobeln von Stirnrädern ist natürlich der Betriebsständer anders aufzustehen, da
hier die Kegelspitze unendlich weit hinausfällt, und es ist außerdem die Stange zu
entfernen, die sich in der Hülse des Betriebsständers schiebt, dafür aber die
Platte, an der jene Stange sitzt, undrehbar an der Mittelplatte festzustellen.
Die Figuren 15
bis 30 zeigen
das Ende eines Drehbankspindelstockes mit einem an die Planscheibe festgespannten
(punktirt angegebenen) zu bearbeitenden conischen Rad, und zwar im Grundriß und
Seitenansicht. Das andere Ende des Spindelstockes mit dem dort anzubringenden
Eintheilungsrade ist weggelassen, weil es nichts wesentlich Neues ertheilt. Erwähnen
wollen wir nur noch, daß alle Räder-Hobel- oder auch Fräsmaschinen aus
der Werkstatt des Chemnitzer Maschinenbauvereins mit verhältnißmäßig sehr großen
Eintheilungsrädern versehen sind, was sehr günstig für die Genauigkeit der erzeugten
Zahnräder wirkt.
Die übrigen Figuren geben verschiedene Detailansichten der Theile des Hobelapparates.
Uebrigens ist das Schaltwerk so eingerichtet, daß es sich nach Vollendung eines
Zahnes von selbst auslegt, was aber der Kleinheit des Maßstabes halber nicht mit
gezeichnet werden konnte. (Deutsche Industriezeitung, 1875 S.
394.)
Tafeln