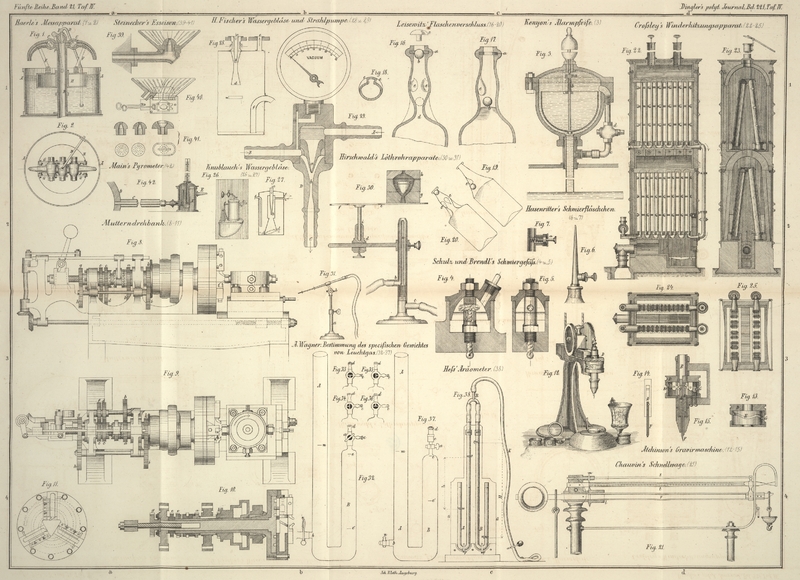| Titel: | Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichtes des Leuchtgases; von Prof. A. Wagner. |
| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 139 |
| Download: | XML |
Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichtes
des Leuchtgases; von Prof. A.
Wagner.
Mit Abbildungen auf Taf.
IV [b.c/3].
Wagner's Apparat zur Bestimmung des spec. Gewichtes des
Leuchtgases.
Der Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichtes von Leuchtgas besteht, wie aus
Figur 32
ersichtlich, aus einer U-förmig gebogenen
Glasröhre von etwa 25mm Durchmesser, deren
längerer Schenkel A 1m und deren kürzerer B 0m,5 Höhe besitzt. An die Röhre A ist ein kleiner Rohransatz b angeblasen, worüber ein Stückchen Kautschukschlauch, der durch den
Quetschhahn n geschlossen werden kann, gezogen ist. Die
Röhre B ist am obern Ende zu einer etwa 7mm weiten Röhre ausgezogen, worauf ein
Messinghahnaufsatz a luftdicht aufgekittet ist, auf
welchem die mit einer feinen Ausströmungsöffnung versehene Röhre d aufgeschraubt wird. Die U-förmige Glasröhre ist an einem soliden Gestell oder an einem
aufhängbaren Brete befestigt.
Für den Gebrauch bringt man zunächst den Hahn a in die
Stellung Figur
33, aus welcher sowie aus Fig. 34 bis 36 die Bohrung
des Hahnes ersichtlich ist. In die Röhre A gießt man von
oben durch eine Trichterröhre destillirtes Wasser ein, so daß die Luft in B durch c entweicht und das
Wasser im Schenkel B bis zum Hahnaufsatz und im Schenkel
A zur gleichen Höhe m
gelangt. Die Ansatzröhre c verbindet man mit einem
Gashahn oder Gasbehälter mittels eines Kautschukschlauches, durch welchen man zuvor
etwas Gas ausströmen ließ. Nun öffnet man, während der Hahn in der Stellung Figur 33
steht, den Quetschhahn n bei b, so daß das Wasser aus beiden Schenkeln ausläuft, jedoch der gebogene
Theil unterhalb b mit Wasser gefüllt bleibt, wodurch das
nun in B befindliche Leuchtgas gegen A abgesperrt ist. Das durch den Kautschukschlauch bei
b ausgeflossene Wasser muß ohne Verlust in einem
Becherglas aufgefangen werden. Nachdem auf angegebene Weise der Schenkel B mit dem zu untersuchenden Leuchtgas gefüllt ist,
bringt man den Hahn in die Stellung Figur 36, wodurch der
Austritt des Gases abgesperrt wird. Das bei b
ausgeflossene Wasserquantum wird nun bei A oben
eingegossen. Da das in B befindliche Gas nicht austreten
kann, so füllt sich hierdurch der Schenkel A fast bis
oben mit Wasser an; im Schenkel B dagegen steht das
Wasserniveau unterhalb der angebrachten Marke e'. Nun
bringt man den Hahn in die Stellung Figur 34, so daß das Gas
nur durch die feine Oeffnung in der Platinplatte bei d
entweichen kann. In Folge dieser Ausströmung des Gases sinkt das Wasserniveau in A und steigt in B. Sobald
das Wasser an die Marke
e' gelangt, wird die Zeit an einer Secundenuhr
notirt und gleichfalls, sobald das Wasser die Marke e
passirt.
Nachdem das Leuchtgas aus B völlig entwichen und
hierdurch das Wasser in A bis m und in B bis zum Hahn wieder gelangt ist,
bringt man den Hahn in die Stellung Figur 33, nachdem man
zuvor den Kautschukschlauch von c entfernt hat. Oeffnet
man nun den Quetschhahn n, so läuft das Wasser bis b aus, und der Schenkel B
hat sich nun gefüllt mit atmosphärischer Luft. Nach Schließen des Hahnes durch die
Stellung Figur
36 gießt man das ausgeflossene Wasser in A
ein, bringt dann den Hahn in die Stellung Figur 34, so daß nun die
Luft durch die feine Oeffnung entweicht, und beobachtet, die Zeit, in welcher das
Wasser im Schenkel B von der untern Marke e' bis zur obern e
gelangt.
Selbstverständlich muß sowohl bei der Bestimmung mit Leuchtgas, als auch bei der mit
atmosphärischer Luft gleiches Wasserquantum angewendet werden.
War z.B. die Ausströmungszeit bei Füllung mit atmosphärischer Luft, bis das Wasser im
Schenkel B von e' bis e stieg, 276 Secunden, und bei Füllung mit Leuchtgas 201
Secunden, so berechnet sich das specifische Gewicht dieses Leuchtgases: s = (201)² : (276)² = 0,5303.Der beschriebene Apparat ist, wie unsere Quelle (Bayerisches
Industrie- und Gewerbeblatt, 1876 S. 134) näher ausgeführt, auch für
andere Gase anwendbar; bei solchen, deren Absorptionsfähigkeit durch Wasser
eine beträchtliche ist, muß Quecksilber zur Füllung des Apparates (Fig.
37, mit Glashähnen a und n) genommen werden.
Tafeln