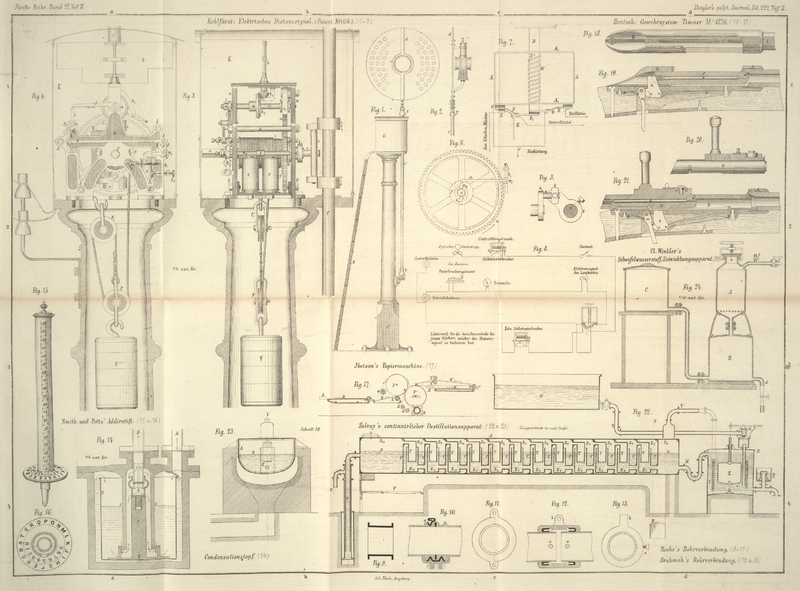| Titel: | Schwefelwasserstoff-Entwicklungsapparat von Cl. Winkler. |
| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 86 |
| Download: | XML |
Schwefelwasserstoff-Entwicklungsapparat
von Cl. Winkler.
Mit Abbildungen auf Taf.
II [d/2].
Winkler's
Schwefelwasserstoff-Entwicklungsapparat.
Der an beiden Enden conisch verjüngte Cylinder A (Fig. 24) dient
zur Aufnahme von 10 bis 15k Schwefeleisen,
welches in etwa wallnußgroßen Stücken auf den falschen Bleiboden zu liegen kommt.
Die Oeffnung a wird durch eine Kautschukscheibe
geschlossen, welche mittels Schraube und eiserner Platte fest angedrückt wird.
An die obere Verjüngung dieses Cylinders ist seitlich ein horizontal abgebogenes
Bleirohr angelöthet, welches zwei Messinghähne trägt. Der größere derselben (c) ist der Haupthahn, durch welchen die Ableitung des
Gases nach dem Raum erfolgt, in welchem es verbraucht wird, und wo dessen
Vertheilung durch eine Anzahl kleiner Hähne bewirkt werden kann, an welche die
Waschflaschen angesetzt sind. Durch entsprechendes Oeffnen des Haupthahnes c kann man den Gasabfluß dem Gesammtbedarf angemessen
regeln, gleichzeitig aber einer Gasverschwendung, wie sie in Laboratorien so oft
vorkommt, vorbeugen. Der Hahn b ist ein einfacher
Fehlhahn, welcher nur beim Füllen und Entleeren des Apparates geöffnet zu werden
braucht. Selbstverständlich müssen die Hähne gut eingeschliffen sein und zeitweilig
gefettet werden. Sie allein vermögen bei mangelhafter Beschaffenheit Gasverluste
herbeizuführen; im Uebrigen sind solche unmöglich, da die Eintragsöffnung durch die
aufgeschraubte, mit Kautschuk geliederte Eisenscheibe hermetisch verschlossen ist
und die Löthnaht absolut dicht hält.
Der Cylinder A, der einschließlich seiner Füllung ein
beträchtliches Gewicht besitzt, wird von einem eisernen Bock getragen, welcher mit
seinen Füßen auf dem Rande des Säuregefäßes B aufruht.
Die Rohrverbindung zwischen beiden erfolgt durch eiserne Flanschen mit Schrauben und
Kautschukring, und es braucht dieselbe selten oder nie gelöst zu werden. Der am
Boden des Gefäßes B angelöthete gekrümmte Rohrstutzen
d dient zum Ablassen der Salzlösung und ist durch
einen Kautschukschlauch mit eisernem Schraubenquetschhahn verschlossen. Früher wurde
ein Hahn aus Hartblei verwendet, der aber abgeworfen werden mußte, weil er bald
undicht wurde, und weil er die Anwendung von verdünnter Schwefelsäure zur
Entwicklung des Schwefelwasserstoffgases nöthig machte; es ist diese aber bei Weitem
nicht so zweckmäßig als diejenige von Salzsäure und hat außerdem, namentlich im
Winter, leicht das Auskrystallisiren von Vitriol und damit das Verstopfen der
Rohrleitungen zur Folge.
In gleichem Niveau mit dem Siedboden des Cylinders A
befindet sich das Gefäß
C, welches als zweites Säurereservoir dient.
Dasselbe steht durch ein Bleirohr mit Flanschenverbindung mit B in Communication. Anfänglich war in der Mitte dieses Rohres ebenfalls
ein Hartbleihahn angebracht, um, nach erfolgtem Zurücksteigen der Säure, den Druck
nach A aufheben zu können; aus den erwähnten Gründen
mußte derselbe jedoch später durch einen Schraubenquetschhahn ersetzt werden;
indessen erscheint auch dieser überflüssig, da der Schluß des ganzen Apparates ein
völlig dichter ist. Um durch den Geruch der mit Schwefelwasserstoff beladenen Säure
nicht belästigt zu werden, schließt man C durch einen
lose aufgelegten Deckel aus Bleiblech.
Zur Füllung des Apparates dient rohe Salzsäure, die mit ihrem gleichen Volum Wasser
verdünnt worden ist, und zwar sind von dieser Säuremischung gegen 40l erforderlich. Das Verdünnen kann gleich
im Gefäß C vorgenommen werden; man läßt die verdünnte
Säure hierauf bei geöffnetem Fehlhahn nach B abfließen
und füllt endlich auch C, jedoch nur reichlich bis zur
Hälfte mit dem erwähnten Gemisch. Um den Apparat vor unberufenen Händen zu schützen,
umgibt man ihn mit einem verschließbaren, schrankartigen Gehäuse, in welches auch
der Haupthahn mit zu liegen kommt; dem letztern gibt man Morgens die richtige
Stellung, während man ihn Abends regelmäßig abschließt. (Nach der Zeitschrift für analytische
Chemie, 1876 S. 285.)
Tafeln