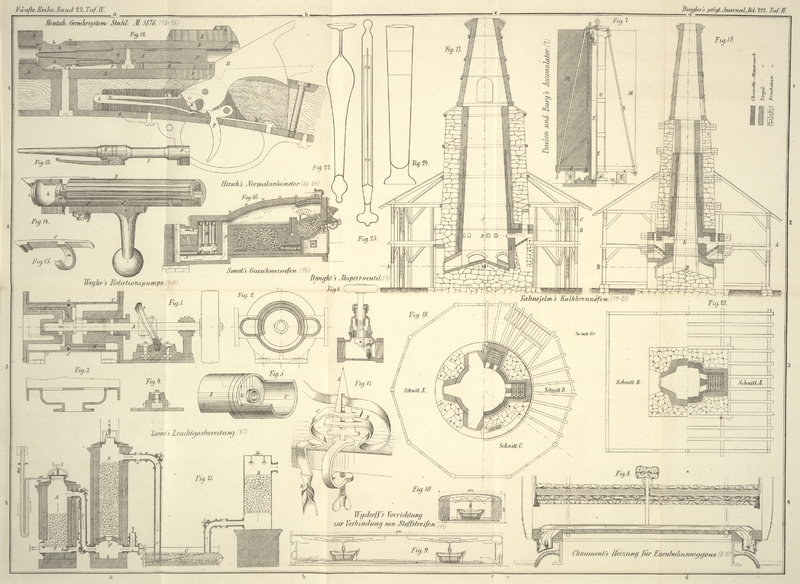| Titel: | W. Weyhe's patentirte Rotationspumpe; von Fr. Ohlendorf. |
| Autor: | Fr. Ohlendorf |
| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 113 |
| Download: | XML |
W. Weyhe's patentirte
Rotationspumpe; von Fr. Ohlendorf.
Mit Abbildungen im Text und auf Taf. IV [a/3].
Ohlendorf, über Weyhe's patentirte Rotationspumpe.
Das Hauptprincip der Weyhe-Pumpe besteht darin, daß durch Rotation eines
Kolbens innerhalb eines geschlossenen Hohlcylinders abwechselnd eine Verengung und
Erweiterung des Cylinderraumes vor und hinter dem Kolben vermittelt, sowie das
Oeffnen und Schließen der Ein- und Ausflußcanäle ohne Anwendung von Ventilen
bewirkt wird. Der Mechanismus der Pumpe ist sehr einfach, überhaupt hat sie als
einzig beweglichen Theil den Kolben. Die Dichtung ist vollkommen und kann mit Hilfe
einer unten näher zu beschreibenden, sinnreichen Vorrichtung nach jeder etwaigen
Abnützung der auf einander gleitenden Theile erneuert werden.
Einrichtung und Wirkung der Pumpe, welche in nachstehendem Holzschnitt I in der Totalansicht und in Fig. 1 bis 5 in verschiedenen Details
veranschaulicht ist, lassen sich in Kürze wie folgt darstellen. Der in dem Cylinder
C befindliche Kolben K
trägt an seinen Enden, aber an entgegengesetzten Seiten, einen an die Cylinderwand
eng anschließenden Schild S bezieh. S' in Form eines Hohlcylindersegmentes. In 1/4
Längenabstand von den beiden Enden befinden sich in der Cylinderwand je zwei
einander gegenüber liegende Oeffnungen, durch welche die Ein- und
Ausflußcanäle in den Cylinderraum münden. Der Querschnitt der Kolbenschilde ist nun
um die Weite einer der Oeffnungen größer als ein Halbkreis, damit der Schild bei der
Rotation des Kolbens den Einströmungscanal in dem Augenblicke öffnet, in welchem er
den gegenüber liegenden Ausflußcanal abschließt. Außerhalb des Cylinders ist mit der
Kolbenachse A eine schräge, etwa im Winkel von
75° zur Richtung der Achse geneigte Kreisscheibe ss fest verbunden, welche sich, während der Kolben rotirt, zwischen den
festen Rollen r und r'
bewegt. Wird nun der Kolben mittels Riemenscheibe oder Kurbel in Rotation versetzt,
so bewirkt die schräge Kreisscheibe gleichzeitig eine vor- und rückgängige
Bewegung des Kolbens innerhalb des Cylinders, wodurch die Räume vor und hinter dem
Kolben abwechselnd verengt und erweitert werden. Sobald der eine Raum anfängt, sich
zu erweitern, schließt der auf dieser Seite befindliche Kolbenschild S die Ausflußöffnung, während er den Einströmungscanal
öffnet.
Fig. 1., Bd. 222, S. 114
Nach einer halben Umdrehung, also am Ende eines Hubes, wird
dagegen letzterer geschlossen und erstere geöffnet, und die vorher aufgenommene
Flüssigkeit wird beim Rückgange des Kolbens ausgestoßen. Da das Einsaugen und Ausstoßen an beiden
Enden des Cylinders abwechselnd erfolgt, so wirkt die Pumpe continuirlich.
Der Kolben mit den beiden Schildern bildet ein Ganzes, ist massiv aus Gußeisen oder
Messing und in der Mitte mit einem Ramsbottom-Ring umgeben; ferner liegen in
dem Zu- und Ausflußcanale des Cylinders bei größern Pumpen noch besondere
Dichtungsringe d, d', welche nach jeder Abnützung des
Kolbens oder der Cylinderwand eine von außen regulirbare Dichtung ermöglichen.
Fig. 2., Bd. 222, S. 115
Bei kleinern, namentlich bei Pumpen für Handbetrieb, welche zum Festschrauben (Holzschnitt II) oder fahrbar (Holzschnitt III) eingerichtet sind, hat der Erfinder folgende
Construction in Anwendung gebracht. Anstatt der schrägen Vorlegescheibe s trägt der Kolben an seinem Umfange eine schräge
Nuthführung (Holzschnitt IV), die aus zwei halben
Schraubenumgängen mit einer Steigung von etwa 15° zusammengesetzt ist, in
welche eine an der Cylinderwand befestigte Rolle eingreift. Dadurch ist also der
Mechanismus, welcher die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens im Cylinder
vermittelt, von außen nach innen verlegt, indem die in der Nuthführung gleitende
Rolle ebenso wirkt, wie die auf der Kolbenachse befestigte Kreisscheibe.
Fig. 3., Bd. 222, S. 116
Fig. 4., Bd. 222, S. 116
Die durch die Einfachheit des Mechanismus ermöglichte feste und solide Construction,
sowie die dadurch bewirkte Betriebssicherheit machen die Pumpe namentlich für
Seeschiffe, Bergwerke etc. als Wasserhaltungsmaschine besonders geeignet. Die
Erfindung ist bereits in 21 Staaten patentirt, und in Halle, Frankfurt und Cöln auf
den diesjährigen Ausstellungen zuerst bekannt geworden. Die Herstellung der Pumpen
hat die Bremer Pumpen- und Motoren-Fabrik
in Bremen übernommen, welche Fabrik auch nach diesem Princip construirte
Dampf- und Wassermotoren liefert.
Tafeln