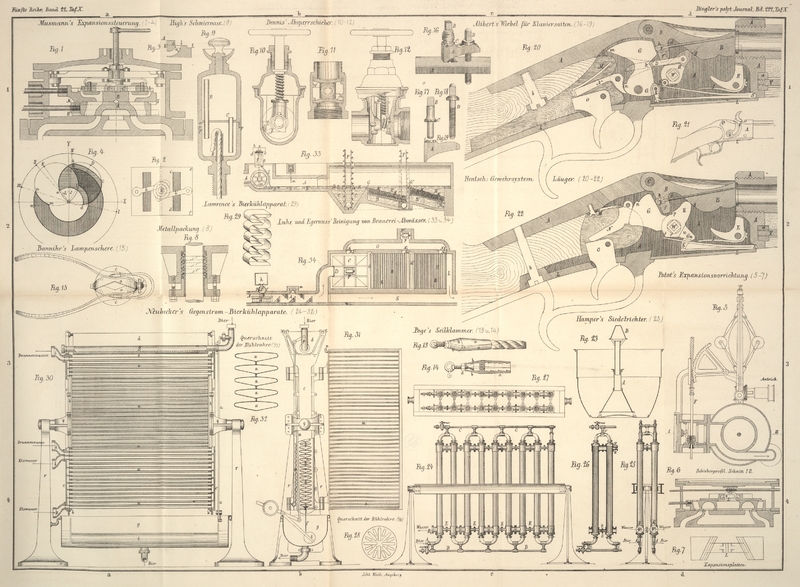| Titel: | Reinigung der Brauerei-Abwässer. |
| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 493 |
| Download: | XML |
Reinigung der
Brauerei-Abwässer.
Mit Abbildungen auf Taf.
X [b.c/2].
Luhe und Egernuß' Reinigung der
Brauerei-Abwässer.
Eine jede Brauerei, welche ihre Cloakenwässer, auch ohne von Sanitätswegen
aufgefordert zu werden, reinigt und dann erst abfließen läßt, wird einen
wesentlichen Vortheil erzielen, welcher in keinem Verhältniß zu den Kosten der
Anlage einer solchen Wasserreinigung steht. Auch sind schon mehrfach die schädlichen
Einflüsse der schmutzigen Wässer auf die Gähr- und Lagerkellerluft, sowie das
darin aufbewahrte Bier nachgewiesen worden.
In der Brauerei Hütteldorf bei Wien ist eine neue derartige Einrichtung im Gebrauche,
welche, soweit sie sich auf die Filtration bezieht, von Wilhelm Luhe und Josef Egernuß
patentirt wurde und in Fig. 33 und 34 im Princip
veranschaulicht ist.
Es wird das gesammte Schmutzwasser in einen Canal A
geleitet, wo dasselbe das unterschlägige Wasserrad a in
Bewegung setzt. An der Zapfenwelle dieses Wasserrades befindet sich ein Kegelrad,
welches in ein zweites Rad auf der stehenden Welle b
eingreift und dieselbe umdreht. Die Welle ist in Seitenstützen gelagert und trägt am
obern Ende ein kleines Stirnrad c, welches durch das
größere Stirnrad d die zweite stehende Welle e mit dem Rührer f in
Bewegung setzt. Dieser Rührer bewegt sich in einem Gefäße g, in welcher die im Kasten h hergerichtete
Kalkmilch einläuft. Durch den Gang des Wasserrades
wird die Kalkmilch umgerührt, und hat das Gefäß g einen
regulirbaren Schieber, welcher durch den schnellern oder langsamern Gang des
Wasserrades, entsprechend dem größern oder geringern Zulauf des Abwassers, sich
derart regulirt, daß dem Wasser durch das Rohr l nicht
mehr Kalkmilch zugefügt wird, als zu dessen Reinigung erforderlich ist.
Ein zweites Gefäß m enthält die übrigen
Desinfectionsmittel, welche außer Kalkmilch zur Reinigung nöthig sind, deren Menge
natürlich nach der Beschaffenheit des zu reinigenden Wassers vorher bestimmt werden
muß. Das am Gefäße m befindliche Ventil wird ebenfalls
durch den Gang des Wasserrades regulirt, wodurch eine ganz verhältnißmäßige
Beimischung herbeigeführt wird, welche durch das Rohr n
zum Canal vermittelt wird.
Der Canal A ist, wie bei B
ersichtlich, mit Versetzsteinen vermauert, so daß das Wasser sich durch diese
Vorrichtung mit der Kalkmilch zuerst und dann mit den übrigen Ingredienzien gehörig
vermischt. Von A fließt nun die ganze Flüssigkeit in ein
größeres Reservoir C; durch den Holzkasten D ist dieselbe genöthigt, ihren Weg nach unten zu
nehmen, und da dieses Reservoir mit einem Sieb E
überdeckt ist, sind die schwerern oder dickflüssigen Bestandtheile zur Ablagerung an
dieser Stelle gezwungen und werden dieselben leicht und ohne das Wasser aufzurühren
durch daß Paternosterwerk (Elevator) F entfernt.
Das nun schon vom schlimmsten Schlamm befreite Wasser drückt sich durch das Sieb E von unten nach oben und fällt durch den schmalen Raum,
welcher bei G durch einen Holzbalken begrenzt ist, in
den untern Theil des Reservoirs H. Von hier aus muß das
Wasser zwischen die in einem Holzgestell eingelegten Holzstäbe K und die hierauf gehäuften Filtrationsbestandtheile,
welche aus einer Lage Kohlenschlacken, dann einer Lage Kokes und endlich Schotter
und Sand bestehen, passiren. Das Wasser steigt hierauf wieder und fällt durch den
schmalen Raum, welcher bei G' ebenfalls mit einem
Holzbalken begrenzt ist, in den untern Raum des wie H
construirten Reservoirs H', in welchem das Wasser
dieselbe Filterprocedur durchzumachen hat, und von wo dasselbe alsdann in den Canal
L abfließt.
Die Oeffnungen M₁, M₂, M₃ der Reservoire C, H und H', welche durch
die Schieber N₁, N₂, N₃ mit dem Canal O correspondiren und sämmtlich in den Schacht P einmünden, worin ein zweites Paternosterwerk F' angelegt ist, dienen dazu, um den sich unter der
Filtrationslage angesammelten Schlamm und Unrath derart zu entfernen, daß immer nur
ein Schieber geöffnet wird und das Paternosterwerk so lange in Thätigkeit bleibt,
bis letzteres reines Wasser fördert, während die Filtration ununterbrochen vor sich
geht.
Der Canal S gestattet bei etwaigen Störungen in der
Filtrationsanlage freien Abzug des Wassers. (Nach der Allgemeinen Zeitschrift für
Bierbrauerei, 1876 S. 95.)
Tafeln