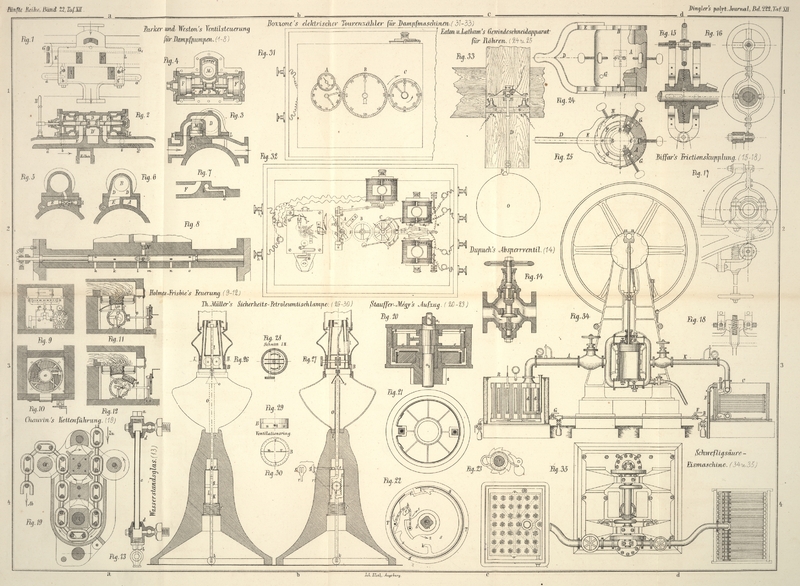| Titel: | Parker und Weston's Ventilsteuerung für Dampfpumpen. |
| Autor: | Sirk |
| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 525 |
| Download: | XML |
Parker und Weston's Ventilsteuerung für Dampfpumpen.
Mit Abbildungen auf Tafel
XII [a/2].
Parker und Weston's Ventilsteuerung für Dampfpumpen.
Die in Figur 1
bis 8 nach Engineering, August 1876 S. 120 skizzirte Steuerung
empfiehlt sich durch selbstthätige Function und compendiöse Zusammenstellung der
innern Dampfvertheilungsorgane. Zur Bewegung der Steuerungsventile sind keinerlei
äußere Mechanismen erforderlich, weshalb eine intermittirende Wirkung der Maschine
möglich ist, welche sonst nur durch complicirtere Vorrichtungen (Katarakte) erreicht
werden kann und für viele Zwecke zur Erzielung einer ausgedehnteren Dampfökonomie
bedingt wird.
Die Dampfvertheilung erfolgt in einem muldenförmigen Gehäuse (Fig. 3 und 6), welches durch
Scheidewände r, r', s und s'
in fünf Räume getheilt ist. Dieses Gehäuse ist dampfdicht auf dem Spiegel KL, befestigt, so daß die aus Fig. 1 und 2 ersichtlichen Spalten
der Cylindercanäle mit den verschiedenen Räumen des Dampfgehäuses communiciren. Der
Kesseldampf gelangt durch die Spalte D in den Mittelraum
D'. Der Raum zwischen den Scheidewänden ist durch
die Canäle E und E' mit den
entsprechenden Cylinderenden verbunden. An den Enden liegt der Ausströmungscanal,
welcher durch die Spalten A und A' den Dampf ins Freie abgibt. Die Wände r, r',
s und s' haben kreisförmige Oeffnungen; die
Steuerwelle f wird durch die beiden Kolben F und F' central in dem
Gehäuse geführt und trägt an einer gemeinsamen Hülse die beiden Eintrittventile B und B', welche abwechselnd
eine der beiden Oeffnungen in s und s' verdecken. Mit den beiden Umkehrkolben F und F' sind die
Ausströmungsventile C und C'
in einem Stück gegossen, welch letztere die beiden andern Oeffnungen in r und r' abschließen. Die
Montirung geschieht derart, daß immer zwei der Ventile abwechselnd aufsitzen.
Wie Fig. 2 und
4
darstellt, ist die Steuerwelle nach rechts aus dem Mittel gerückt, und es strömt
links der Dampf bei B ein, während bei C' sich die rechte Cylinderhälfte in den
Ausströmungscanal entleert. Der Kolben befindet sich hierbei auf seinem Wege nach
rechts, und man sieht, daß bei dieser Anordnung der Dampfkolben dem Schieber
nachfolgt. Die Maschine kann daher in Bewegung gesetzt werden, indem man das
Ventilsystem mittels des Handhebels H (Fig. 2) der erwünschten
Kolbenbewegung entsprechend bewegt, bis die automatische Thätigkeit der Ventile
eingeleitet ist. Die Steuerung dient für beide Bewegungssinne, und eine gesonderte
Umsteuerung ist nicht erforderlich, indem die selbstthätige Function der Ventile die Maschine im
anfänglich ertheilten Sinne von der Drehung der Schwungradwelle unabhängig
weiterbewegt.
Die Steuerungsventile werden unmittelbar durch den Dampfdruck auf die beiden Kolben
F und F' bethätigt. Bei
Stellung der Figur
2 wird Arbeitsdampf durch die Bohrung abc an das linke Ende des Gehäuses zugelassen, während rechts der Raum
hinter dem Kolben F' durch die Bohrung c
'
b
'
a' mit dem Ausströmungsrohr verbunden ist. Die
Steuerwelle wird daher durch den Ueberdruck des Arbeitsdampfes auf F in seiner Stellung rechts gehalten, wobei das Ventil
C aufsitzt und B'
geschlossen hält. Ist nun der Kolben in seinem Lauf über die Oeffnung a' gelangt, so strömt hier bei c' frischer Dampf zu, und der Druck auf die beiden Kolben F und F' kommt ins
Gleichgewicht; da nun das Ausströmventil C größer ist
als das Ventil B', so verschiebt sich die Ventilspindel
nach links, bis das Ventil C' aufliegt und B den Dampfzufluß für die linke Cylinderseite
abschließt. Der Dampf nimmt in den Canälen E und E' den umgekehrten Lauf, der Kolben tritt seinen Rückweg
an, bis er nach a gelangt und neuerdings ein Umstellen
der Schieberventile veranlaßt.
Ein genaues Studium der besprochenen Steuerungstheile führt bald zur Erkenntniß, daß
durch das Umkehren der Dampfwege der beschriebene Vorgang der selbstthätigen
Steuerung ungünstig beeinflußt wäre; es ist deshalb auch in dem Umkehrcanal abc eine Kugel eingebettet, welche, wie Figur 5 zeigt,
sammt dem Gehäuse durch Lösen einer Schraube leicht ausgehoben und gereinigt werden
kann. Die Umkehrbohrung abc ist durch die Oeffnung
g mit dem Cylindercanal E in Verbindung; analog ist die Einrichtung auf der andern Seite. Die
Wirkungsweise ist demnach folgende: Sobald der Dampf bei Kolbenbewegung nach links
durch die Oeffnung a nach b
gelangt, wirft er die Kugel d vor die Bohrung g, so daß der Kesseldampf nicht in den Canal E übertritt und letzterer nur mit ausströmendem Dampf
gefüllt ist. Die Ventile werden umgestellt; nun communicirt a' mit dem Ausströmungscanal, während rechts der Dampf in den Cylinder
tritt. Dies müßte zur Folge haben, daß die Ventile wieder in ihre vorige Stellung
zurückkehren, bevor der Dampfkolben die Oeffnung a'
überschritten hat und diese wieder mit dem Kesseldampf in Verbindung gebracht wäre.
Ein Rückströmen des Dampfes von dem Steuerkolben ist aber nicht möglich, weil der
eintretende Dampf im Canal E die Kugel d (Fig. 5) an die rechte
Oeffnung wirft und den Canal b abschließt. Diese Kugel
d ist also zur richtigen Function der Steuerung
unerläßlich.
Wie man sieht, ist die Dampfvertheilung eine momentane, indem der Steuerkolben ruckweise die
beiden erforderlichen Stellungen einnimmt, während der Dampfkolben die todten Punkte
durchläuft. Theoretisch können wir uns in die Steuerung nicht einlassen; sie wirkt
von diesem Gesichtspunkte aus vollkommen richtig, und es wird von der praktischen
Ausführung und von der Natur des Materials zumeist abhängen, inwieweit die Erwartung
auch im praktischen Betrieb gerechtfertigt wird. Sollte auch ein dichtes Aufliegen
der Ventile erreicht und trotz der Wärmeausdehnung der einzelnen Organe ein
bedeutender Reibungswiderstand vermieden werden können, so muß es doch von
vornherein gegen eine Steuerung einnehmen, wenn deren Function von der Spannung des
Kesseldampfes so abhängig ist wie hier; es läßt sich leicht die Minimalspannung
bestimmen, bei welcher die richtige Wirkung der Steuerung ganz illusorisch wird.
Außerdem wird der Dampfverlust durch die beträchtlichen schädlichen Räume noch im
Moment des Umkehrens der Dampfwege dadurch vermehrt, daß ein directes Ueberströmen
von D durch den Raum r, s
bezieh. s', r' in die Ausströmung stattfinden kann, weil
die Ventile B, C und B', C'
nicht gleichzeitig geschlossen sind. Dieser Uebelstand könnte noch beseitigt werden,
wenn B, B' innerhalb zweier Ansätze verschiebbar
angebracht würden.
Eine gesonderte Vorrichtung zur Erreichung eines variablen Füllungsgrades ist in Figur 8
dargestellt. In der cylindrischen Bohrung G (Fig. 3) ist ein
Messingrohr eingepaßt, welches von außen durch das Stellrad S gedreht und beliebig eingestellt werden kann, so daß eines der in einer
Schraubenlinie angeordneten Löcher der Hülse mit einer der entsprechenden Bohrungen
h, k, l, m, n oder o
(Fig. 8)
zusammenfällt. Hat der Kolben diese bestimmte Oeffnung überschritten, so tritt Dampf
ein, wirkt durch das Ventil N auf die untere Fläche des
Expansionsventiles M (Fig. 3) und schließt den
Dampfweg ab. Durch ein Verdrehen des Stellrädchens S
kann also eine an gewisse Marken gebundene Veränderlichkeit des Expansionsgrades
erreicht werden. Das Doppelventil O muß eingeschaltet
werden, um ein Ueberströmen des Dampfes von h nach o oder k nach n unmöglich zu machen. Es würde dies eintreten, so lange
der Kolben sich zwischen den beiden Oeffnungen bewegt, welche eben mit dem Innern
des Cylinders communiciren und die Grenzen der Dampffüllungen kennzeichnen.
Der Dampf, welcher über das Ventil N getreten ist und das
Expansionsventil gehoben hat, kann auf dem gleichen Wege nicht zurückdringen,
sondern strömt durch einen gesonderten Canal in die Ausströmung über, welcher Canal
durch eine Sperrschraube verengt werden kann. Das Expansionsventil wird aber erst
Dampf zulassen, nachdem die Spannung des Dampfes unter dem Expansionsventil sich vermindert hat und
letzteres durch sein eigenes Gewicht fällt. Man mag es daher erreichen, daß der
Kolben in den todten Punkten beliebig pausirt, indem man jene Sperrschraube mehr
schließt. Der Vortheil, welcher hieraus für gewisse Zwecke erwächst, darf als
bekannt angenommen werden, wie wir auch beifügen, daß wir alle Vor- und
Nachtheile, welche der vorgeführten als „Ventilsteuerung“
anhaften, nicht in Erwägung ziehen wollten.
Dampfpumpen mit dieser Steuerung baut die Coalbrookdale-Company in
Shropshire.
Sirk.
Tafeln