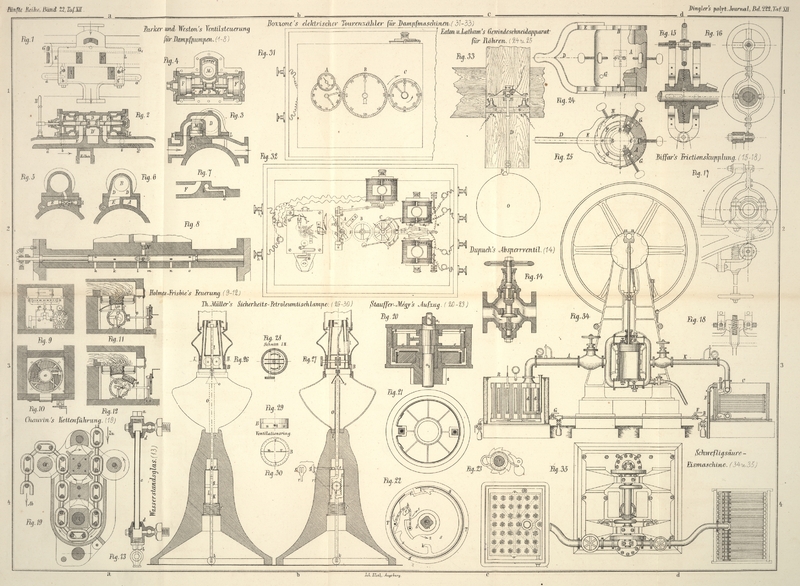| Titel: | Wasserstandszeiger. |
| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 529 |
| Download: | XML |
Wasserstandszeiger.
Mit einer Abbildung auf Taf. XII [a/4].
Wasserstandszeiger.
Wohl fast alle bisher in Anwendung gekommenen Wasserstandszeiger sammt ihren neuesten
Verbesserungen haben die Art der Befestigung des Glases in den Hahnköpfen mittels
Stopfbüchse und Hanf oder Gummiringe gemein, und grade dieser Verpackungsweise ist
wohl in den meisten Fällen das öftere Zerspringen der Gläser zuzuschreiben. Denn
selten werden die Hahnköpfe in der Weise über einander montirt, daß die beiden
Achsen genau eine gerade Linie bilden; wird nun außerdem die Hanfdichtung oder der
Gummiring nicht ganz gleichmäßig eingelegt, so müssen die Stopfbüchsen, um ein
Dichthalten zu erzielen, übermäßig angezogen werden, das Glas wird einseitig
gedrückt, steckt schief, ist eingezwängt und muß zerspringen. Alle diese Uebelstände
sind nach Uhland's Practischem Maschinenconstructeur, 1876 S. 353 durch die in Figur 13
dargestellten Hahnköpfe vermieden.
Die Dichtung und Befestigung des Glases bei diesen Hahnköpfen geschieht, wie aus der
Zeichnung klar ersichtlich, nur durch Einlegen conischer Gummiringe, welche aus
gefilztem Gummi hergestellt sind und der Hitze größern Widerstand leisten als
gewöhnliches Gummi.
Das Einziehen der Gläser geschieht nun einfach auf folgende Weise: Man entfernt die
Schlußschraube a beim obern Hahnkopfe, sowie das
Ablaßhähnchen b beim untern, führt das Glas c ein, steckt oben und unten Gummiringe d auf das Glas und drückt sie mit einem Finger leicht in
den conischen Sitz im Hahnkopfe; hat man sich nun noch überzeugt, daß das Glas seine
richtige Stellung hat, also die Hahndurchgänge frei und nicht vom Glase überdeckt
sind, so schraubt man oben die Schlußschraube, unten den Ablaßhahn wieder ein und
das Glas wird beim sofortigen Gebrauch gut dicht halten.
Das Glas kann sich hier frei ausdehnen, verträgt auch eine verschiedene Ausdehnung
der Hahnköpfe gegen einander und wird auf keinerlei Weise gezwängt. Auch dürfte
diese Art der Einziehung eines Glases kaum die Hälfte der Zeit beanspruchen, die man
nöthig hat, um ein Glas einzuziehen bei Hahnköpfen mit Stopfbüchsen.
Diese Hahnköpfe werden jedenfalls billiger zu liefern sein als andere, da sie
einestheils weniger Material enthalten und anderntheils geringern Arbeitsaufwand bei
der Herstellung bedingen. Auch werden in den meisten Fällen die Hahnköpfe nach altem
System sich leicht nach dieser neuen Art einrichten lassen.
Derartige Hahnköpfe sind u.a. von E. F. Hering in Zittau
zu beziehen.
Tafeln