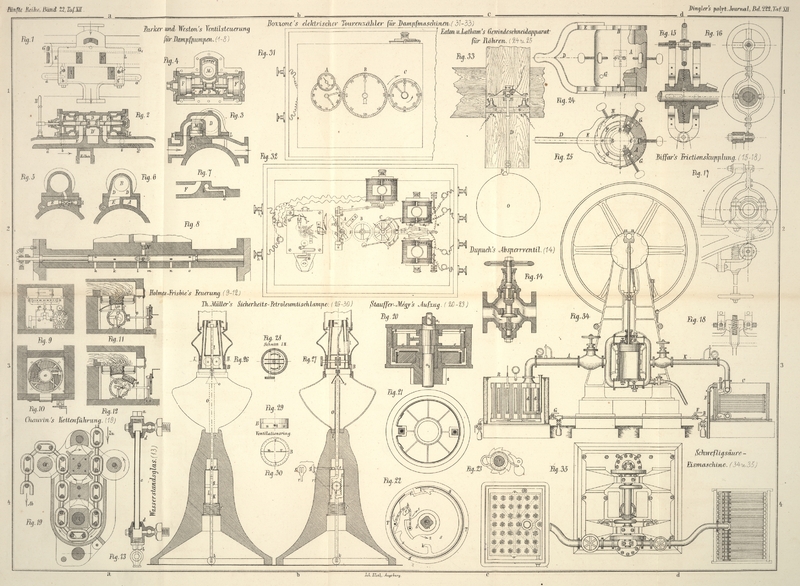| Titel: | Schwefligsäure-Eismaschine für die künstliche Eisbahn (Glaciarium) zu Chelsea. |
| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 556 |
| Download: | XML |
Schwefligsäure-Eismaschine für die
künstliche Eisbahn (Glaciarium) zu Chelsea.
Mit Abbildungen auf Taf.
XII [d/3].
Eismaschine für Eisbahnen.
Die künstliche Eiserzeugung im Kleinen bietet dem Chemiker und Fabrikanten
bekanntlich keine besondern Schwierigkeiten dar. Anders jedoch gestaltet sich die
Frage, wenn es sich darum handelt, einen Eisspiegel von beträchtlicher Ausdehnung
(wie z.B. das Glaciarium zu Chelsea) durch künstliches Gefrieren direct zu erzeugen
und unter Beobachtung einer hinreichend niedrigen Temperatur in einem zum
Schlittschuhlaufen geeigneten Zustande zu erhalten.
Zur Herstellung einer künstlichen Eisbahn sind außer der mechanischen Triebkraft drei
Dinge erforderlich: das in Eis zu verwandelnde Wasser, das Kälteerzeugungsmittel und
das die Kälte auf das Wasser übertragende Medium. Letzteres ist nothwendig, weil das
Gefriermittel mit dem
Wasser nicht in unmittelbare Berührung gebracht werden kann. Bei der Eisbahn zu
Chelsea, der einzigen bis jetzt (Mai 1876) existirenden Anstalt dieser Art, dient
als solches Medium eine Glycerinlösung und als
Kälteerzeugungsmittel schweflige Säure. Diese Säure ist
bekanntlich im gewöhnlichen Zustande ein Gas von 2,212 spec. Gew., welches jedoch
unter einem Druck von 1at bei 0°
oder durch Erkältung, indem man es durch ein bis –18° abgekühltes Rohr
leitet, tropfbar flüssig wird. Das specifische Gewicht der schwefligen Säure als
Flüssigkeit ist 1,45.Der Unternehmer der erwähnten Eisbahn, Hr. Gamgee,
bezieht die schweflige Säure für die Zwecke seines Glaciariums aus der
Schweiz und zwar in starken kupfernen Flaschen, welche einige Centner
Flüssigkeit fassen. Bei einer Temperatur von –10° befindet
sich die Flüssigkeit in normalem Zustande und übt keinen Druck aus.
Fig. 34 und
35
stellen den Eiserzeugungsapparat des Glaciariums zu Chelsea im senkrechten
Durchschnitte und im Grundrisse dar. Man bringt die Säureflasche auf einen kleinen,
mit einer Wage versehenen Rollwagen und läßt ein Quantum Flüssigkeit von gegebenem
Gewichte durch die Röhre B in den untern Theil des
Condensators C fließen. Der letztere wird direct von der
Wasserleitung aus mit Wasser von gewöhnlicher Temperatur gespeist. Er ist mit einem
System von Doppelröhren versehen, deren jede aus einem äußern 25mm weiten und einem innern 16mm weiten Rohre besteht, welche einen
ringförmigen Raum zwischen sich lassen. Das Wasser tritt bei D ein, fließt durch die engern Röhren und erreicht den Boden des
Condensators durch die aufwärts gebogenen Rohrenden. Es steigt alsdann durch den
Condensator in die Höhe und verläßt denselben durch das Abflußrohr E. Auf diese Weise findet ein fortwährender Wasserzufluß
und eine vollkommene Circulation statt.
Sobald nun der Hahn G geöffnet wird, geht die bis jetzt
noch flüssige schweflige Säure bei ihrem Eintritt in den Refrigerator R in Gasform über, wobei sie auf das 300fache ihres
ursprünglichen Volums sich ausdehnt. Der Hahn F hat
erforderlichen Falles die Verbindung zwischen dem Condensator und dem Refrigerator
abzusperren. Das Röhrensystem des letztern besteht aus Gruppen dünner Röhren, welche
von weiten Röhren d umschlossen sind. Die nunmehr
gasförmige schweflige Säure steigt durch die Röhren d in
den obern Theil des Refrigerators, wo die Röhren befestigt sind. (Jedes Pfund
schweflige Säure, welches seinen Weg durch die Röhre A
nimmt, absorbirt 170 englische Wärmeeinheiten.)
Eine doppelt wirkende Pumpe, welche ein relatives Vacuum von ungefähr 50mm Quecksilberhöhe erzeugt, kommt nun in
Thätigkeit. Theils durch dieses Mittel, theils vermöge ihrer eigenen Spannkraft,
steigt die schweflige Säure in das Rohr A, dessen
Temperatur eine sehr niedrige ist, um alsdann durch das Rohr K, dessen Temperatur eine hohe ist, in den Condensator C gepreßt zu werden. Das Manometer zeigt einen Druck von
ungefähr 1at,5, welcher unter Mitwirkung
des Wassers zur Recondensation des Gases hinreicht. Wenn die schweflige Säure, deren
Uebergang von dem gasförmigen in den tropfbarflüssigen Zustand mit dem Eintritt in
das Rohr K beginnt, in den Condensator gelangt, so tritt
sie zunächst in die Kammer, worin die Doppelröhren angeordnet sind, und fließt durch
die ringförmigen Räume zwischen der einen Röhrenhälfte bis zu einem Absperrhahn,
dann durch die andere Hälfte, gelangt zum Boden des Condensators und endlich von da
wieder zurück in den Refrigerator R, um ihren Kreislauf
von Neuem zu beginnen. Die Temperatur der schwefligen Säure variirt von –6
bis –2°.
Die Pumpenventile aus sogen. Bristol-Bronze mit gußstählernen Spindeln haben
sich vollständig bewährt. Die schweflige Säure greift, da sie mit der Atmosphäre nie
in Berührung kommt, die Maschinentheile nicht im Geringsten an.
Das die Kälte übertragende Medium ist eine wässerige Lösung von braunem Glycerin,
welche in unterirdischen Cisternen aufbewahrt wird. Dieselbe hat einen sehr
niedrigen Gefrierpunkt. Eine Lösung von gleichen Theilen Glycerin und Wasser ist
praktisch nicht zum Gefrieren zu bringen. In Chelsea bedient man sich einer Mischung
von 4 Th. Glycerin auf 6 Th. Wasser, welche bei –18° erstarrt. Diese
Flüssigkeit wird zunächst in eine an dem obern Theile des Refrigerators R angebrachte Kammer gepumpt, um bis zur erforderlichen
Temperatur erkältet zu werden. Sie fließt durch die innern, an die Kammer
befestigten Röhren des Refrigerators hinab. Letztere sind von der schwefligen Säure
umgeben, welche, wie oben erwähnt, die weiten Röhren d
ausfüllt. Die Glycerinlösung gelangt in eine flache gußeiserne Kammer am Boden des
Refrigerators, worin sie sich durch ein System radialer Röhren vertheilt. In
hinreichend erkältetem Zustande wird sie vorsichtig und unter Vermeidung heftiger
Bewegung in einen ungefähr 3m über dem
Boden angebrachten hölzernen Behälter gepumpt. Aus diesem fließt sie vermöge ihrer
eigenen Schwere durch ein 150mm weites Rohr
hinab, um ein System dünner kupferner Röhren zu durchfließen, welche längs des
Bodens der Schlittschuhbahn parallel neben einander angeordnet sind. Diese Röhren
besitzen einen elliptischen Querschnitt, dessen beide Achsen 76 und 22mm betragen. Der Raum zwischen diesen
dünnen Röhren variirt zwischen 3 und 6mm,4.
Nachdem die Glycerinlösung dieses Röhrensystem durchlaufen und ihre erkältende
Wirkung auf das umgebende Wasser des Bassins ausgeübt hat, fließt es in den
Refrigerator zurück, um in diesem von Neuem zu einer niedrigen Temperatur abgekühlt
und in den Behälter hinauf gepumpt zu werden. Während des ganzen, auf diese Weise
sich wiederholenden Kreislaufes aus dem Refrigerator in den Behälter, aus diesem
durch das Röhrensystem des Bassins und von da wieder zurück in den Refrigerator
variirt die Temperatur der Flüssigkeit nur wenige Grade.
Das auf die beschriebene Weise künstlich erzeugte Eis der Schlittschuhbahn
unterscheidet sich vortheilhaft von dem natürlichen Eis. Da es nämlich direct auf
Beton und Planken liegt, so hat der Schlittschuhläufer weder Risse noch Biegungen zu
befürchten, und da es bei einer sehr niedrigen Temperatur gefroren ist, so ist es
härter und dichter als gewöhnliches Eis. (Nach dem Engineer, 1876 Bd. 41 S. 371.)
P.
Tafeln