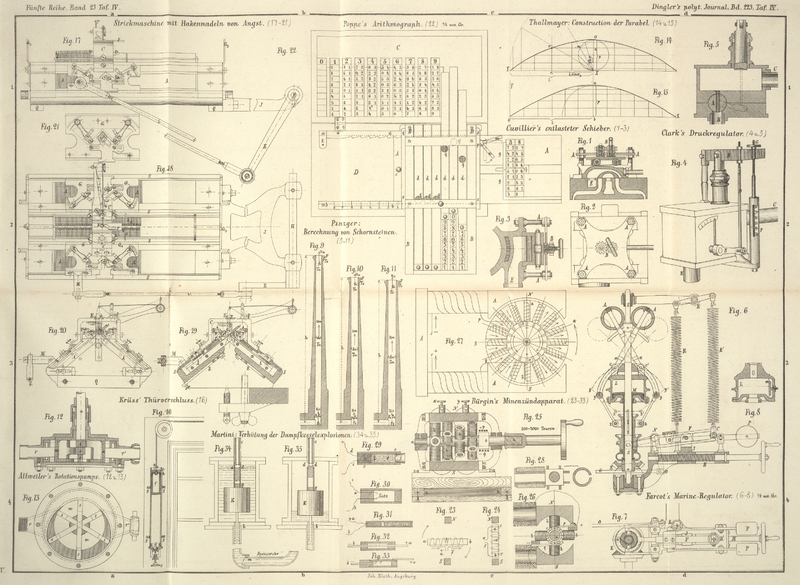| Titel: | Zur Verhütung der Dampfkesselexplosionen. |
| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 182 |
| Download: | XML |
Zur Verhütung der
Dampfkesselexplosionen.
Mit Abbildungen auf Taf.
IV [b/4].
Zur Verhütung der Dampfkesselexplosionen.
In einem kleinen Hefte bespricht Martini die Ursachen der
Dampfkesselexplosionen. Nach seiner Ansicht kann durch mangelhafte Kessel zwar auch viel Unheil
entstehen, aber eine eigentliche Explosion wird allein dadurch niemals herbeigeführt
werden. Eine Explosion wird niemals entstehen ohne einen
zu niedrigen Wasserstand, aber der niedrige Wasserstand allein wird auch keine Explosion zur Folge haben, wenn nicht eine weitere
Ursache hinzutritt.
Zur Begründung dieser Ansicht gibt Verfasser an, daß er im Laufe der letzten 20 bis
30 Jahre eine ziemliche Anzahl Kessel gesehen habe, welche ausgebrochen und durch
neue ersetzt waren; fast bei allen solchen meistens lange Jahre im Gebrauch
gewesenen Kesseln fand er Stellen, welche von außen her tief eingerostet, so daß man
mit einem Hammerschlage Beulen oder gar Löcher einschlagen konnte, und dennoch war
keiner dieser Kessel zum Explodiren gekommen. Er habe ferner eine Anzahl
Cornwall-Kessel gesehen, welche theils ausrangirt, theils noch im Gebrauch
waren, in welchen an der obern Wand des Feuerrohres sich Stellen befanden, welche
sichtbar in glühendem Zustande eingedrückt und zum Theil angebrannt waren, und doch
hatte dabei keine Explosion stattgefunden.
Martini meint dann, es werde kein Sachverständiger
darüber im Zweifel sein, daß sich überall da, wo das Wasser im Kessel so tief
gesunken, daß die Wände des Dampfraumes längere Zeit vom Feuer berührt worden,
Wasserstoff durch Zersetzung des Wassers entwickeln könne und müsse. Es bedürfe dann
nur noch des Hinzutrittes von atmosphärischer Luft und die Explosion des gebildeten
Knallgases könne oder vielmehr müsse erfolgen. Daraus schließt der Verfasser nun,
daß zwei Umstände zusammentreten müssen, um eine Explosion herbeizuführen, nämlich
Erglühen der Kesselwand und Eindringen atmosphärischer Luft; wäre nur das Eine oder
das Andere allein schon dazu hinreichend, so würden solche Explosionen gar nicht zu
den seltenen Fällen gehören, denn unter den in Betrieb befindlichen Kesseln werden
sich nicht viele finden, in welchen nicht wenigstens schon einmal das Wasser weit
unter dem niedrigsten Stande gewesen.
Da sich seiner Ansicht nach somit die Entwicklung von Wasserstoffgas nur schwer
vermeiden läßt, so ist es von der größten Wichtigkeit, Mittel anzuwenden, wodurch
das Eindringen der im Speisewasser gelösten atmosphärischen Luft in den Dampfraum
des Kessels gänzlich verhindert wird. Er glaubt diese Aufgabe durch Construction
eines kleinen Apparates gelöst zu haben und gibt sich der Hoffnung hin, daß damit
die jetzt noch vorhandene Gefahr beinahe als beseitigt angesehen werden dürfte!Vgl. Fr. Martini: Ueber Dampfkesselexplosionen,
deren zum Theil unbekannte Ursachen und Mittel zu ihrer Verhütung. 16 S.
Preis 1 M. (Eberfeld 1876.)
Die Figuren 34
und 35
stellen zwei verticale Längenschnitte dieses Apparates dar, und zwar zeigt Figur 34
denselben in dem Zustande, in welchem sich keine Luft in demselben befindet, in
welchem Falle derselbe durch den selbstthätigen Verschluß bei dd nach außen abgesperrt ist. Figur 35 stellt den
Apparat in dem Zustande dar, wo sich in demselben so viel Luft angesammelt hat, daß
der Schwimmer K, nicht mehr von Wasser umgeben, sich
gesenkt hat, um durch die dadurch entstandenen Oeffnungen bei dd die Luft entweichen zu lassen, welche
Oeffnungen sich aber sofort wieder schließen, wenn das steigende Wasser die Luft
ausgetrieben und den Schwimmer wieder gehoben hat.
Der Apparat, welcher bei b an der obern Kesselwand so
befestigt wird, daß ein hermetischer Verschluß vorhanden, besteht aus zwei Theilen.
Der obere Theil von c bis b
kommt über den Kessel zu stehen und besteht aus einer runden, sorgfältig abgedrehten
Eisenstange; dieselbe ist oben von c bis d der Länge nach, also vertical durchbohrt, bei dd in der Richtung des Durchmessers, also
horizontal durchbohrt; dadurch entstehen zwei Oeffnungen in der Stange, welche in
der Mitte derselben zusammentreffen und durch die verticale Oeffnung von d bis c mit der äußern Luft
in Verbindung stehen.
Ueber der Eisenstange befindet sich eine eng anschließende Messingröhre, an deren
unterm Ende bei g eine hermetisch sorgfältig
verschlossene Metallbüchse K in solider Weise befestigt
ist. Diese Metallbüchse (als Schwimmer dienend) darf nicht allzu leicht und
specifisch etwa halb so schwer sein als Wasser, so daß deiselbe, im Wasser sich
befindend, wenigstens annähernd eben so viel Steigkraft besitzt, als außerhalb des
Wassers ihr absolutes Gewicht beträgt.
Die an der Metallbüchse befestigte Röhre ist so eingerichtet, daß sie sich auf einem
kurzen Wege etwa 10 bis 15mm lang hin und
her (also hier auf- und niederwärts) bewegen kann, ferner so, daß sie sich an
der Stange nicht drehen kann. Damit aber die Röhre beim Auf- und Niedergehen
keiner zu starken Reibung ausgesetzt ist und doch an der Stelle bei dd einen sichern Verschluß bildet, ist die Röhre
von oben her auf mehrere Centimeter der Länge nach durchschnitten, so daß beide
Hälften durch den dann darauf wirkenden Dampf- resp. Wasserdruck noch dichter
an die Stange bei dd sich anschließen; auch muß
die Röhre oberhalb der Metallbüchse bei g eine oder zwei
Oeffnungen haben, damit beim Auf- und Niedergehen der Büchse in den untern
Theil der Röhre Wasser ein- und austreten kann. Diese Oeffnungen, sowie auch
der Längeneinschnitt in die Röhre, konnten in den Zeichnungen wegen der Richtung des
Querschnittes nicht angedeutet werden.
Die bis jetzt beschriebene Eisenstange nebst Röhre und Metallbüchse oder Schwimmer
ist in ein cylindrisches, oben und unten mit einem Deckel versehenes Gefäß so
eingeschlossen, daß ein kleiner Theil der obern (durchbohrten) Stange aus dem obern
Deckel herausragt, während der untere Deckel mit der Röhre, welche in den Kessel
führt, in einer solchen Verbindung steht, daß das Wasser im Kessel in das außerhalb
des Kessels befindliche Gefäß leicht eindringen und wieder zurückgehen kann.
Der untere Theil des Apparates besteht nur aus einer innerhalb des Kessels
angebrachten, in den untersten Wasserraum hinreichenden und unten trichterförmig
auslaufenden Röhre. In diesen Trichter wird aus dem Speiserohr bei m das Speisewasser hinein geführt. –
Der Verfasser scheint bei Aufstellung dieser Hypothese über die
Dampfkesselexplosionen übersehen zu haben, daß nach den Versuchen des Franklin
Institutes (1836 61 418) 1839 71 269) Wasser in einem rothglühenden Kessel, dessen Oberfläche zwar rein,
aber nicht metallisch glänzend ist, nicht zersetzt wird.
In einem Kessel mit Krustenbildung ist natürlich gar nicht an eine solche Zersetzung
zu denken, und doch finden sich in explodirten Kesseln sehr oft ganz bedeutende
Kesselsteinbildungen. Aber selbst dann, wenn sich Wasserstoff entwickeln sollte, und
wenn auch die zur Bildung von Knallgas erforderliche Menge atmosphärischer Luft mit
dem nicht vorgewärmten Speisewasser eingeführt wäre, so würden diese Gase doch so
rasch durch den Wasserdampf über die Explosionsgrenze hinaus verdünnt und
weggeführt, daß an eine Dampfkesselexplosion durch Knallgas nicht zu denken ist
(vgl. 1874 213 299).
F.
Tafeln