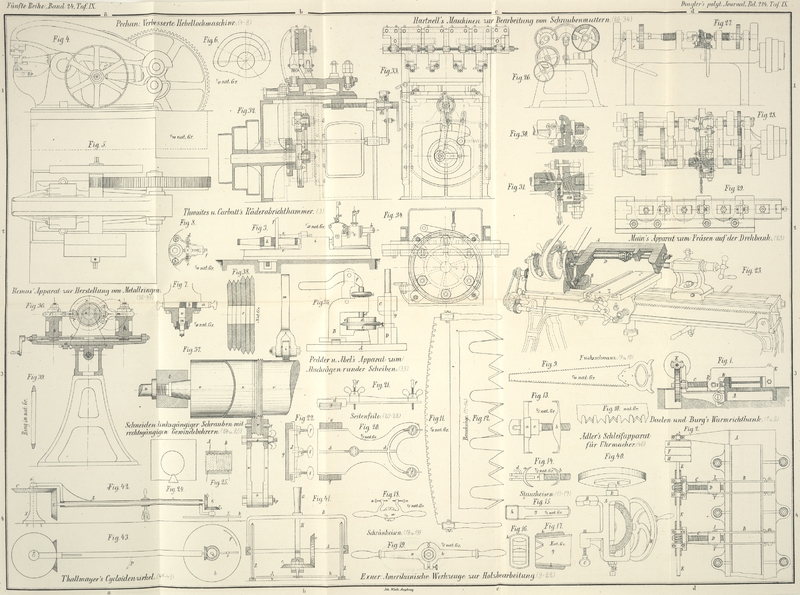| Titel: | Verbesserte Hebellochmaschine; von Maschinen-Ingenieur Josef Pechan. |
| Autor: | Josef Pechan |
| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 369 |
| Download: | XML |
Verbesserte Hebellochmaschine; von Maschinen-Ingenieur Josef
Pechan.
Mit Abbildungen auf Taf.
IX [a/1].
Pechan, über eine verbesserte Hebellochmaschine.
Bezüglich der Form der Hebellochmaschine gilt dasselbe, was in dem Referate über Law's doppelte Hebelschere (S. 37 dieses Bandes) bezüglich der Form der
Hebelscheren im Allgemeinen gesagt wurde. Auch diese Form ist ziemlich veraltet,
verdient aber nichts desto weniger auch heute noch Beachtung, wenn die Maschine 1)
durch passende Anordnung des Antriebes und entsprechend gewählte Bett- und
Hebelformen besonders kurz und leicht, 2) durch Anwendung von Excenterdaumen zur
Bewegung des Lochhebels möglichst einfach gehalten ist und 3) in ihren
Geschwindigkeitsverhältnissen bezieh. in den durch die Form des Excenterdaumens
erreichbaren wechselnden Uebersetzungsverhältnissen allen Anforderungen der Theorie
des Lochens entspricht.
Auf Grund dieser Bedingungen ist die von der Ottakringer Eisengießerei und
Maschinenfabrik in Wien gebaute Hebellochmaschine construirt, welche in Fig. 4 und 5 in Ansicht
und Grundriß dargestellt ist.
Bei dieser Maschine liegt die Antriebwelle, welche einerseits mit Fest- und
Losscheibe, anderseits mit entsprechend schwerem Schwungrade versehen ist, in der
Mitte des Bettes. Die beiden Enden derselben sind mit viereckigen Ansätzen versehen,
auf welche Kurbeln aufgesteckt werden können, falls das Lochen durch Handbetrieb
bewerkstelligt werden soll. Die Standplätze der an den Kurbeln treibenden Arbeiter
befinden sich dann in zu beiden Seiten der Maschine vorhandenen Gruben. Beim
Riemenbetrieb sind diese Gruben überdeckt. Von der Antriebwelle wird die rotirende
Bewegung durch Räder übersetzung im Verhältnisse von 1:10 auf eine zweite, im
Bettende gelagerte Welle übertragen, auf welcher der Excenterdaumen festgekeilt ist.
In dem oberhalb des Excenterdaumens befindlichen schirmförmig gebildeten Ende des
Lochhebels ist, auf einer kurzen Achse befestigt, eine Laufrolle gelagert, welche
durch das Eigengewicht des Lochhebels stets an dem Excenterdaumen anliegend erhalten
wird. Durch diese Laufrolle wird die Bewegung vom Excenterdaumen auf den Lochhebel
übertragen.
Die Theorie des Lochens lehrt nun, daß der beim Lochen auftretende Widerstand von
Null anfangend bis zu einer von der Blechdicke und dem Lochdurchmesser und in
gewissem Grade von der Arbeitsgeschwindigkeit abhängigen maximalen Größe steigt; daß
ferner dieser maximale Widerstand nach Erreichung einer bestimmten Eindrucktiefe
seitens des Lochstempels bezieh. der Matrize auftritt, wobei die Trennung des
Zusammenhanges in der ganzen Umgrenzung des Putzens gleichzeitig erfolgt; daß es
endlich, nachdem der Putzen losgetrennt ist, nur noch nöthig ist, denselben aus dem
bereits fertigen Loche hinauszuschieben, da er vermöge der entlasteten Elasticität
einen etwas größern Umfang aufweist als das Loch, welchem derselbe entstammt; daß
daher der maximale Widerstand nach der Trennung des Zusammenhanges plötzlich sehr
bedeutend abnimmt und mit dem Hinausfallen des Putzens wieder auf Null sinkt. Die auf den
Lochstempel übertragene Kraft braucht deshalb anfangs nur gering zu fein, muß aber
dann dem wachsenden Widerstände entsprechend vergrößert werden und im Momente des
Auftretens des maximalen Widerstandes ebenfalls ihr Maximum erreichen. Dieser
Bedingung kann in einfachster Weise durch die Anwendung von entsprechend geformten
Excenterdaumen vollkommen entsprochen werden. In der That entspricht ihr der in Figur 6 in 1/10
n. Gr. gezeichnete Excenterdaumen, welcher bei der in Rede stehenden
Hebellochmaschine zur Anwendung gebracht wurde. Wie ein Vergleich der
eingezeichneten Radien ergibt, erfolgt der Niedergang des Lochstempels erst rasch
bis an das zu lochende Blech heran, worauf er, mit abnehmender Geschwindigkeit
weiter bewegt, in das Blech eindringt. In dem Momente des Auftretens des maximalen
Widerstandes aber erreicht die Geschwindigkeit des Niederganges des Lochstempels ihr
Minimum. Das Zurückziehen des Lochstempels erfolgt wieder rasch durch das
Eigengewicht des Lochhebels, wobei die Druckrolle am Excenterdaumen anliegend frei
niederrollt. Zum Niederhalten des Bleches beim Aufwärtsgange des Lochstempels ist an
einem am Bette angeschraubten schmiedeisernen Arme ein der Höhe nach verstellbarer
Abstreifer angebracht.
Die beiden Hebelarme des Lochhebels stehen bei dieser Maschine im Verhältnisse von 1
: 2.
Ein interessantes Detail zeigt die in Figur 7 im Durchschnitte
dargestellte Vorrichtung zum Abstellen des Lochstempels. Der beiderseits mit
Handgriffen versehene Schieber a ist bei b mit einer cylindrischen Bohrung versehen, in welche
das ober dem Lochstempel m befindliche Druckstück n eintritt, wenn der Schieber a nach links geschoben ist. Befindet sich der Schieber a aber in der hier gezeichneten Stellung, so liegt das
Druckstück an demselben an, wodurch der Lochstempel am Zurückweichen verhindert
ist.
In Figur 8 ist
noch der verstellbare Matrizenhalter im Grundrisse dargestellt. Derselbe besitzt an
seiner Unterseite einen cylindrischen Zapfen c, welcher
in eine Aussparung des Bettes reicht. Mittels dieses Zapfens wird der Matrizenhalter
durch die beiden Stellschrauben d und e so lange nach rechts oder nach links, und mittels der
Stellschraube f so lange nach vorn oder nach rückwärts
verstellt, bis der Lochstempel in die Matrize paßt. Diese drei Stellschrauben finden
ihr Muttergewinde in dem Aufsatze des Bettes, auf welchem der Matrizenhalter
aufliegt. Ist der Matrizenhalter richtig eingestellt, so wird er mittels der beiden
Befestigungsschrauben g und h, welche ihr Muttergewinde ebenfalls im Aufsatze des Bettes finden,
festgeschraubt. Der Lochstempel aber ist nicht seitlich verstellbar; er ist jedoch gut geradegeführt, so
daß er, wenn durch die Rechtsstellung des Schiebers a.
(Fig. 7)
eingerückt, stets wieder dieselbe Stellung gegen die Matrize einnimmt.
Als ein Vorzug der beschriebenen Hebellochmaschine ist noch hervorzuheben, daß
sämmtliche Schmierlöcher dem Arbeiter sehr bequem zur Hand liegen.
Tafeln