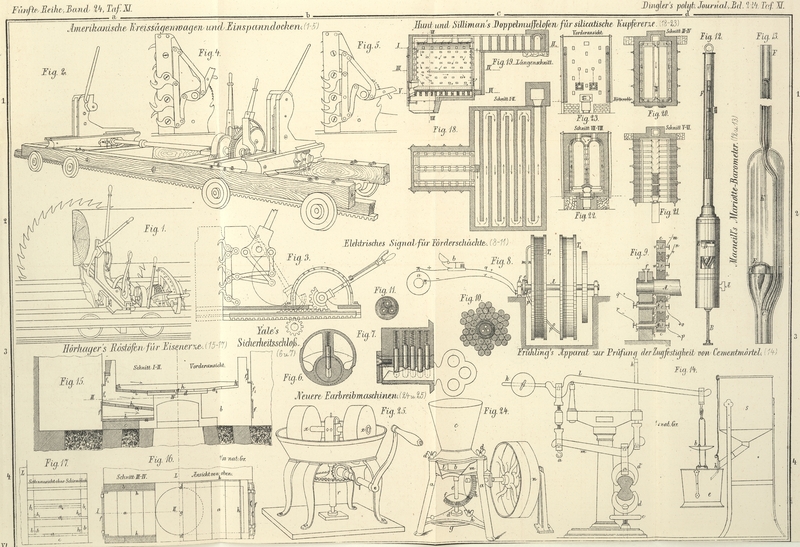| Titel: | Röstofen für Eisenerze; von J. Hörhager. |
| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 509 |
| Download: | XML |
Röstofen für Eisenerze; von J. Hörhager.
Mit Abbildungen auf Taf.
XI [a/3].
Hörhager's Röstofen für Eisenerze.
Jos. Hörhager zu Bundschuh bei Mauterndorf (Salzburg) hat
kürzlich (in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen,
1877 S. 179) ein recht praktisches Verfahren für kleinen Betrieb angegeben, die bei
offener Gicht gewöhnlich unbenutzt bleibenden Hohofengase, welche man über der
Gichtöffnung brennen sieht, zum Rösten bezieh. Trocknen und Vorwärmen der Erzgichten
zu verwenden. Zu diesem Zwecke wird auf dem Hohofen ein kleiner Röstofen (Fig. 15 bis
17) so
aufgestellt, daß die ins Freie brennenden Gase das Erz vor dem Aufgeben von mehrern
Seiten umspülen. Auf zwei einander diametral gegenüber stehenden Seiten der
Gichtöffnung befindet sich je ein massiv aus Ziegelsteinen gemauertes Fundament c, welches das Mauerwerk des Kernschachtes nicht
überdeckt. Auf c liegen die bis zur Gichtöffnung
vorspringenden gußeisernen Platten a, welche die
ebenfalls aus Ziegelsteinen aufgeführten Pfeilerchen b
tragen; letztere dienen ihrerseits wieder als Unterlage für die Platten a1, auf welchen die
Pfeilerchen b1, ruhen.
Das Ganze wird durch die Platten a2 bedeckt, welche außerdem auf den an beiden Enden
unterstützten Platten d ruhen und die Gichtöffnung bis
auf den schmalen Schlitz g überdecken. Auf diese Weise
werden sechs Etagen hergestellt, drei zu jeder Seite der Gichtöffnung. Die
entweichenden brennenden Hohofengase werden dadurch gezwungen, die Platten a, a1 und a2 theils von einer, theils von beiden Seiten zu
belecken. Zum Reguliren der die Zwischenräume der Etagen durchströmenden Gase dienen die Fallthüren
f bis f2, sowie eine mit Handgriff versehene Platte, durch
welche der Schlitz g nach Belieben bedeckt werden
kann.
Die auf den Hohofen geförderten Erze werden durch die Fallthüren auf die
verschiedenen Etagen gebracht und dort ausgebreitet. Jede Etage faßt eine Gicht.
Hierbei dienen die Fallthüren gleichzeitig zum Schutz der Arbeiter gegen die
andringende Flamme. Sind die Gichten im Hohofen so tief gesunken, daß er wieder
gefüllt werden soll, so gibt man zuerst die Kohlen oder Kokes auf und entleert dann
eine der Etagen, indem man das darauf befindliche Erz in der Richtung der in Figur 15
eingezeichneten Pfeile in den Ofen stößt. Dies geschieht mit eisernen Krätzern, die
man durch die Fallthüren einbringt. Die seillich aufgestellten Platten h und h1 dienen zum Schutz des Mauerwerkes beim Füllen und
Entleeren der Etagen. Ist eine Etage frei, so wird sie gleich wieder mit einer
frischen Erzgicht belegt.
In Bundschuh, wo dieses Verfahren zuerst eingeführt worden ist, will Hörhager dadurch eine Brennmaterialersparniß von 10 Proc.
erzielt haben, bei einer um 15 Proc. erhöhten Tagesproduction. Der dortige Ofen wird
mit Holzkohlen betrieben, verarbeitet eine bei 40 Proc. Eisen und 20 Proc. Wasser
enthaltende Beschickung, in welcher sich 42 Proc. arme, mulmige Brauneisensteine
befinden. Das Gewicht einer Erzgicht ist 224k, und wöchentlich werden etwa 56 000k Roheisen
abgestochen.
—r.
Tafeln