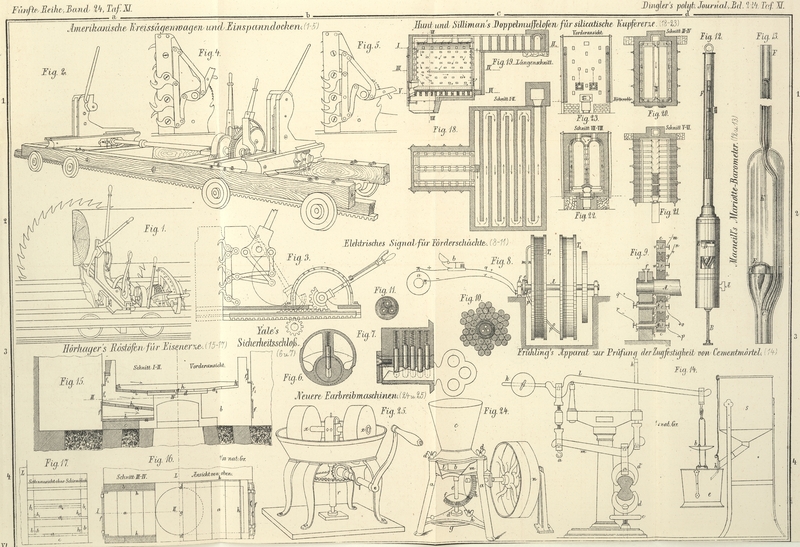| Titel: | Zwei Farbreibmaschinen neuerer Construction. |
| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 540 |
| Download: | XML |
Zwei Farbreibmaschinen neuerer
Construction.
Mit Abbildungen auf Taf.
XI [b.c/4].
Zwei Farbreibmaschinen neuerer Construction.
Die bei Besprechung des Chromgrüns für Baumwolldruck empfohlene trichterförmige,
ursprünglich nur für Oelfarben bestimmte Farbreibmaschine (1874 211 387), wie sie Pabst und
Lambrecht in Nürnberg und Wilh. Stierle in Heilbronn anfertigen, hat sich seitdem in den Druckfabriken
immer mehr Eingang verschafft. Da bei jener Gelegenheit eine eingehende Beschreibung
dieser Maschine sich nicht in den Rahmen der Abhandlung fügte, so mag dieselbe
jetzt, wo eine neue Art solcher Apparate zum Vorschein kommt, nachgeholt werden.
Das Gestell der ersteren Maschine Figur 24 besteht aus
einem eisernen Dreifuß, welcher mittels dreier Schrauben auf einem Tisch wie bei
Handbetrieb, oder auf dem Fußboden wie bei Maschinenbetrieb befestigt ist. Im
Mittelpunkt der die drei Füße a verbindenden Platte
befindet sich eine Oeffnung für die senkrechte, durch die Zahnräder f und k drehbare Spindel e. Das untere Ende derselben ruht auf dem Hebel g, während das obere Ende die Reibplatte b trägt, deren untere Seite durchwegs, deren obere
Seite nur am äußern Rande eine ebene Fläche vorstellt so zwar, daß sie in der Mitte
schwach convex ist, daß jedoch die Wölbung gegen die Peripherie der Scheibe in eine
vollkommen ebene, glatte Fläche, die eigentliche Reibfläche, verläuft. Mittels der
Flügelschrauben d wird der conische, oben und unten
offene Farbbehälter c auf das Gestell festgeschraubt;
derselbe endigt auf seiner untern Seite in einem horizontalen Ring, welcher genau
auf jene Reibfläche paßt. Die Farbe wird von oben in den Behälter zugegeben, der
gewölbte Theil der drehbaren Scheibe b bildet den Boden
des Behälters, und die Farbe wird um so feiner zerrieben, je fester die Schraube h angezogen wird, d. h. je stärker die auf dem Hebel g ruhende Spindel e und mit
ihr die Platte b gegen jenen horizontalen ringförmigen
Ansatz des Behälters c angedrückt wird. Setzt man nun
die Maschine in Bewegung, so zieht sich die zu reibende Farbe nach unten gegen und
zwischen die beiden Reibflächen, zwischen den feststehenden obern und den sich
drehenden untern Ring. Dieselbe rotirende Bewegung zwingt auch die gemahlene Farbe
gegen und über die Peripherie der beiden Reibflächen hinaus, von wo sie, durch einen
sich federnden, metallischen Abstreicher l aufgefangen,
in die Weißblechrinne m und von hier in ein beliebiges
untergestelltes Gefäß niederfallen muß. Um auch die gröbern Theile einer Farbe
zwischen die beiden Reibflächen zu führen, so verläuft der convexe Theil der Scheibe
b nicht glatt gegen den äußern flachen Theil
derselben, sondern in einer Reihe kurzer radialer Furchen, in welchen etwaige
Knollen und Klümpchen sich fangen, und für den eigentlichen Eintritt zwischen die
beiden Reibflächen verarbeitet werden.
Die Mahlung, welche diese Maschine liefert, ist eine sehr feine und sogar bei den
kleinern Ausführungen, welche nicht für Maschinenbetrieb, sondern nur für
Handbetrieb mittels Kurbel und Schwungrad oder auch ohne letzteres verfertigt sind,
eine verhältnißmäßig rasche und wenig Kraft erfordernde. Sie gelingt bei allen
Farben von einem gewissen zähen Zusammenhalt, wie Chromgrün (zuerst mit dem Glycerin
allein, dann nochmals mit der Blutalbuminlösung gerieben), Albuminorange,
Küpenreserve; sie läßt sich aber nicht ausführen mit pulverförmigen Substanzen, ob
sie trocken, oder, wie der Indigo, mit Wasser angerührt in Verwendung kommen.
Die im Moniteur de la Teinture, 1876 S. 272 vorgeführte
neuere, ebenfalls aus einer andern Branche herübergenommene, für den Gebrauch der
Färbereien hergerichtete Farbmühle hat den Vortheil, daß sie auch für trockne und
mit Wasser angerührte Pulverfarben verwendbar ist. Die Construction ist einfach, und
aus Figur 25
leicht die Aehnlichkeit
mit dem bekannten Kollergang ersichtlich. Die mit Eisen beschlagenen verticalen
Mahlsteine, welche bei der kleinsten Ausführung eine Dicke von 11 cm und einen
Durchmesser von 33 cm
haben, führen in dem Mahlkasten, dessen Durchmesser 60 cm beträgt, eine zweifache Bewegung aus,
sie drehen sich in Folge der Kurbelbewegung um die senkrechte Spindel r und in Folge der Reibung am Boden des Kastens um ihre
gemeinsame horizontale Achse xx und zerdrücken so die ihnen von den Spateln fortwährend auf ihrem
Weg vorgelegte Farbe in ein feines Pulver oder in einen zarten Teig. Die Maschine
verarbeitet auch die härtesten Pulver, und zwar ohne Geräusch, ohne Stoßen und ohne
Stauben.
Ki.
Tafeln