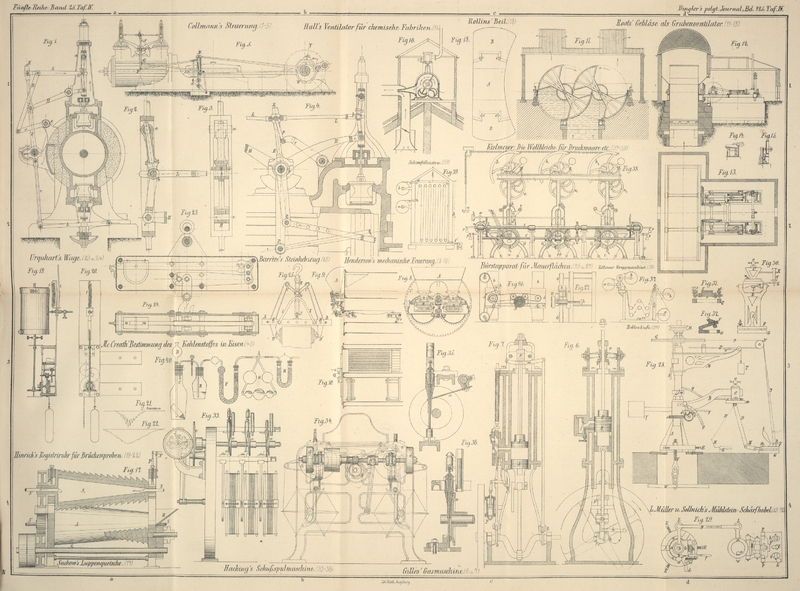| Titel: | Collmann's Steuerung. |
| Autor: | Müller-Melchiors |
| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 316 |
| Download: | XML |
Collmann's Steuerung.
Mit Abbildungen auf Taf.
IV [a/1].
Collmann's Steuerung.
Es wäre ein vergeblicher Versuch, diese neue, von A. Collmann, Civilingenieur in Wien, in allen Industriestaaten patentirte
Steuerung irgend einer Classe bereits bestehender Constructionen einzureihen; so
sehr sie auf den ersten Anblick der Sulzer-Steuerung ähnelt, so grundverschieden ist sie von derselben; und
ebenso wenig schließt sie sich einer andern Steuerung an. Das entscheidende Merkmal
der Collmann-Steuerung ist das Eingreifen des
Regulators als continuirlich wirkendes Steuerorgan und das Entfallen des
Auslösemechanismus, welchem nicht mit Unrecht von Collmann vorgeworfen wird, daß der beliebte
„momentane“ Schluß des Dampfeintrittes nicht herbeigeführt
werden darf, wenn nicht Ventile und Schieber rasch
zerstört werden sollen. Mit Rücksicht hierauf behauptet Collmann bei seiner Steuerung ebenso raschen Schluß erzielen zu können,
als bei einer rationell regulirten Corliß- oder Sulzersteuerung zulässig ist
– eine Ansicht, welcher wir im Hinblick auf die Erhebungsdiagramme der
Ventile, wie sie sich aus dem geometrischen Zusammenhange der Steuerung ergeben,
zwar nicht zustimmen können, die aber anderseits durch die scharfen Ecken uns
vorliegender Originaldiagramme der Collmann'schen Maschinen insoweit bekräftigt
wird, daß sich die Raschheit des Schlusses als vollkommen genügend erweist. Hiermit
aber wird die Steuerung durch den Wegfall der stets empfindlichen Buffervorrichtung,
sowie der abschnappenden Kanten verhältnißmäßig einfach und auch für höhere
Tourenzahlen anwendbar.
Die Skizzen Fig.
1 bis 3 zeigen die wesentlichen Bestandtheile der neuen Steuerung, welche wir
uns zunächst ohne Eingriff des Regulators, mit fester Expansion denken wollen. Aus
Figur 1,
Querschnitt durch den Cylinder, ist Eintritt- und Austrittventil für das eine
Cylinderende, ersteres oberhalb, letzteres unterhalb des Dampfcylinders ersichtlich.
Die Steuerwelle w, welche längs des Cylinders läuft,
wird von der Schwungradwelle durch Kegelräder angetrieben und erhält die gleiche
Tourenzahl wie diese. An den beiden Cylinderenden ist sie ausgekröpft – oder
auch mit einem Excenter versehen – und trägt hier die Excenterstange Ee, welche mittels des einarmigen Hebels h direct das Austrittventil bewegt und mittels des
zweiarmigen Hebels H die Bewegung des Eintrittventiles
einleitet. Die Steuerung ist für den Beginn der Dampfadmission, kurz vor dem todten
Punkte gezeichnet, die Welle w rotirt in der Richtung
des Pfeiles.
Wäre nun das kurze Ende c des zweiarmigen Hebels H
fest und direct mit der Spindel des Eintrittventiles
verbunden, so hätten wir volle Füllung während des ganzen Hubes; findet die
Verbindung durch einen Auslösemechanismus statt, so
erhalten wir Expansionssteuerungen wie die Hartmann'sche
(* 1874 214 267), Hartung'sche
(* 1876 222 205) u.a. Die Collmann-Steuerung dagegen hat (während der Arbeitsperiode) die
Verbindung zwischen dem Hebel H und dem Eintrittventil
zwar fest, aber nicht direct,
sondern mittels eines Kniehebels bewerkstelligt, welcher
das charakteristische Kennzeichen der neuen Steuerung repräsentirt. Derselbe ist in
seinem obern Scharnier a mit der rahmenartig erweiterten
Ventilspindel, am untern Scharnier c mit dem Hebel H fest verbunden; der mittlere Bolzen b
dagegen trägt eine Lenkerstange L, deren anderes Ende
wir vorläufig mit der verlängerten Excenterstange E fest
verbunden und die Regulatorhebel R und r weggelassen denken wollen. Dann wird beim Beginn der
Bewegung in der Richtung der Pfeile in Figur 1 sowohl der Hebel
H den Punkt c heben, als
L den Punkt d nach
rechts drücken und das Kniehebelgelenk strecken; beide Bewegungen addiren sich und
geben ein rasches Anheben des Punktes a sowie des mit
ihm fest verbundenen Eintrittventiles. Bei weiterer Drehung der Welle w behält c seine
aufsteigende Bewegung fort, ebenso bewegt sich der Punkt b dauernd nach rechts, da wir die Excenterstange E um den Angriffspunkt des Hebels H als
Fixpunkt schwingend annehmen können. Dabei aber kommt der Kniehebel, nach rechts
ausgebogen, alsbald aus seiner gestreckten Stellung und vermindert den Abstand der
Punkte a und c fortwährend,
bis endlich, gegenüber der Anfangsstellung, a ebenso
tief gesunken ist, als c vom Hebel H gehoben worden war, d.h. das Ventil ist wieder auf
seinen Sitz gesunken und die Expansion beginnt.
Die Bewegung der Hebel H und L dauert selbstverständlich im selben Sinne fort, bis der Excenterzapfen,
beiläufig bei halbem Kolbenhub, seine tiefste Stellung erreicht hat, worauf auch der
Punkt c nach abwärts geht, während b noch fortwährend von L
nach rechts geschoben wird. Beide Bewegungen, welche sich früher subtrahirt hatten,
würden sich nun addiren, um den Punkt a herabzuziehen,
was jedoch unmöglich ist, da derselbe fest mit dem aufsitzenden Ventile verbunden
ist. Deshalb wird Punkt b mit a nicht durch eine feste Stange, sondern durch die teleskopartige
Construction verbunden, welche in Fig. 2 und 3 dargestellt ist. Man
ersieht, daß der Punkt a dem Punkte b bei der Aufwärtsbewegung unter allen Umständen folgen
muß, sobald sich die beiden Tellerflächen des mit a
verbundenen Rohres und der mit b verbundenen Stange
getroffen haben; beim Rückgange von b folgt dagegen a durch das Eigengewicht von Ventil und Spindel, sowie
unter dem Druck einer schwachen Feder, welche über der Ventilspindel angebracht ist;
sobald das Ventil aufsitzt und d weiter sinkt, verlassen
sich die Tellerflächen und berühren sich erst wieder, wenn der Excenterzapfen seine
volle Umdrehung durchlaufend wieder in die Anfangsstellung der Figur 1 gelangt ist.
Nach dem Vorausgeschickten ist klar, wie sich durch den combinirten Einfluß der
beiden „Hauptbewegungen“, wie sie Collmann nennt, der Schluß des Ventiles bedingt. In der ersten Hubhälfte
wirkt der Lenker L durch Verkürzung des Kniehebels dem
aufsteigenden Hebel c
entgegen, in der zweiten
Hubhälfte vereinigen sich beide Bewegungen zum Niederlassen des Ventiles; unter
allen Umständen erfolgt der Schluß des Ventiles um so rascher, je mehr die
Kniehebelwirkung zur Geltung kommt, denn bei dem extremen Falle der Figur 1 findet fast sofort
nach dem Eröffnen auch wieder der Schluß des Ventiles statt, während beim Wegfallen
des Lenkers L und der starren Verbindung zwischen den
Punkten c und a die Füllung
während des ganzen Hubes dauern müßte. Letzterer Fall, d.h. die Eliminirung des
Kniehebeleinflusses wird nahezu erreicht, wenn die Lenkerstange L, statt im höchsten Punkte der Excenterstange E zu stehen, in die tiefste Stellung zum Angriffspunkte
des Hebels H gelangt, da wir denselben, wie oben
bemerkt, für die Bewegung des Lenkers gewissermaßen als Fixpunkt ansehen können; in
den Zwischenstellungen finden dann selbstverständlich die mittlern Füllungsgrade
statt.
Wenn wir daher die Lenkerstange L nicht fest mit der
Excenterstange E verbinden, sondern durch eine Führung
auf E verschiebbar machen, so können wir alle
Füllungsgrade von 0 bis 90 Proc. erreichen. Dies geschieht bei der
Collmann-Steuerung direct durch den Regulator, welcher mittels der Welle x und der Hebel r, R, mit
der Lenkerstange L in Verbindung steht. Die Functionen
der Steuerung werden somit vollkommen verständlich und die eingangs gemachten
Bemerkungen gerechtfertigt sein; hervorzuheben ist noch, daß der Regulator, um die
Lenkerstange stets in ihrer Stellung zu erhalten, jedenfalls einen größern
Kraftaufwand ausüben muß, als bei einer Auslössteuerung; daß aber diese Bedingung
ohne Schwierigkeit zu erfüllen ist, zeigt sich an den verschiedenen nach Collmann's Patent ausgeführten Maschinen, wo der
Regulator überall vortrefflich functionirt.
In der hier betriebenen Weise bringt Collmann seine
Steuerung bei den normalen, neu zu bauenden Umtriebsmaschinen an; zum Umbau
bestehender Maschinen und für Reversirmaschinen überhaupt wäre dagegen die längs des
Cylinders laufende Steuerwelle schwer verwendbar. Da sich aber die zwei Hauptbewegungen der Steuerorgane einfach zerlegen lassen,
und zwar in eine bis zum halben Hub aufgehende und dann zurückgehende Bewegung des
untern Kniehebelpunktes, sowie eine zweite Bewegung, welche das
Kniehebel-Mittelscharnier während des ganzen Hubes nach einer Seite
hindurchbiegt, so erhellt sofort, daß sich das gewünschte Resultat auch einfach mit
zwei Excentern erreichen läßt, von denen das eine um 90° (mehr dem Voreilen)
vor der Kurbel aufgekeilt ist und das zweite mit der
Kurbelrichtung zusammenfällt. Von diesen beiden Excentern treibt dann das erstere
durch den Hebel P eine Rohrwelle p (Fig.
4), von welcher sich nach jedem Cylinderende ein Hebel H erstreckt, der mit dem untern Kniehebelpunkte c verbunden ist. Der an das Mittelscharnier gehängte Lenker L dagegen vereinigt sich im Cylindermittel mit dem
Lenker der andern Cylinderseite zu einem gemeinsamen Gleitstück, welches auf der
Stange E durch die Hebel R,
r und die Welle x wie früher von dem Regulator
oder vom Maschinenführer verschoben wird, um die Füllung zu wechseln. Es ist nun
leicht erklärlich, wie die Stange E auf der durch p hindurchgehenden Welle q
aufsitzt und von dieser mittels des Hebels Q und des
zweiten mit der Kurbel coïncidirend aufgekeilten Excenters während des ganzen
Hubes nach rechts gedreht wird. Die Austrittventile werden von zwei weitern, auf der
Welle p sitzenden Hebeln angetrieben und sind gewöhnlich
neben den Eintrittventilen angeordnet; übrigens ist selbstverständlich, daß in
dieser Richtung die verschiedensten Modificationen zulässig sind.
Die Anwendung auf Reversirmaschinen ist in Figur 5 dargestellt. Die
oben beschriebene Anordnung der Ventile und Excenter bleibt im allgemeinen
beibehalten, die Maschinenkurbel bewegt sich in der Richtung des Pfeiles, das
Excenter der ersten Hauptbewegung, welches die Welle p
treibt, ist in der Richtung V aufgekeilt, gegen die
Normalstellung eines Vorwärtsexcenters um 180° verdreht, da die Bewegung
durch die Welle p umgekehrt wird. Das Excenter W der zweiten Hauptbewegung, welches nach dem oben
gesagten beiläufig mit der Kurbel coïncidiren sollte, ist um ebenso viel vor der Kurbel aufgekeilt, wie V
hinter der Kurbel zurücksteht. Dadurch werden die
höchsten Füllungsgrade, vielleicht von 70 Proc. an, allerdings unmöglich gemacht;
dagegen ergibt sich eine äußerst einfache Reversirung. Die Excenterstangen von V und W greifen nämlich an
den beiden Enden einer Coulisse M an, welche von einem
unten liegenden Drehpunkt mittels Hängeeisen getragen wird und aus zwei getrennten,
geraden Gleitbahnen besteht. In der einen derselben ist die Stange des Hebels P, in der andern die Antriebsstange von Q geführt, beide durch Führungsstangen derart mit einem
doppelarmigen Hebel d verbunden, so daß sie immer die
entgegengesetzten Enden der Coulisse einnehmen. Wenn daher in Figur 5 die Stange von P oben, von Q unten in die
Coulisse eingreift, so wird die Steuerwelle p von V, q von W aus, wie in Figur 4,
gesteuert und die Maschine rotirt in der Richtung des Pfeiles. Wird dagegen der
doppelarmige Hebel d in seine andere Endstellung
gebracht, so kommt nun p unter den Einfluß von W, q unter die Führung von V, und die Maschine ist umgesteuert. Die Zwischenstellungen der Coulisse
werden selbstverständlich nicht verwendet, da die Expansion unabhängig hiervon durch
den Hebel r von Hand gestellt wird.
In dieser Gestalt läßt sich die Collmann-Steuerung leicht zum Umbau
bestehender Fördermaschinen mit Ventilsteuerung verwenden, ohne daß in der Anordnung
der Ventile die geringste Aenderung erforderlich wäre. Aber nicht allein den hier
beschriebenen Fällen, sondern allen überhaupt denkbaren Maschinen- und
Steuerungsdispositionen hat Collmann seine Steuerung
angepaßt – in einer Weise, welche ebenso das Genie des Erfinders, als die
allgemeine Anwendbarkeit seiner Steuerung bewährt. Hervorragende Maschinenfabriken
in DeutschlandDieselbe wird von der „Görlitzer Maschinenbau-Anstalt und
Eisengießerei“ in Görlitz und von L. A. Riedinger in Augsburg u.a. ausgeführt. haben die Ausübung des Collmann'schen Patentes
übernommen, und, obwohl die Erfindung ihr erstes Jahr noch nicht vollendet hat, ist
schon eine Reihe von Maschinen mit Collmann-Steuerung versehen in dauerndem
Betriebe.
Müller-Melchiors.
Tafeln