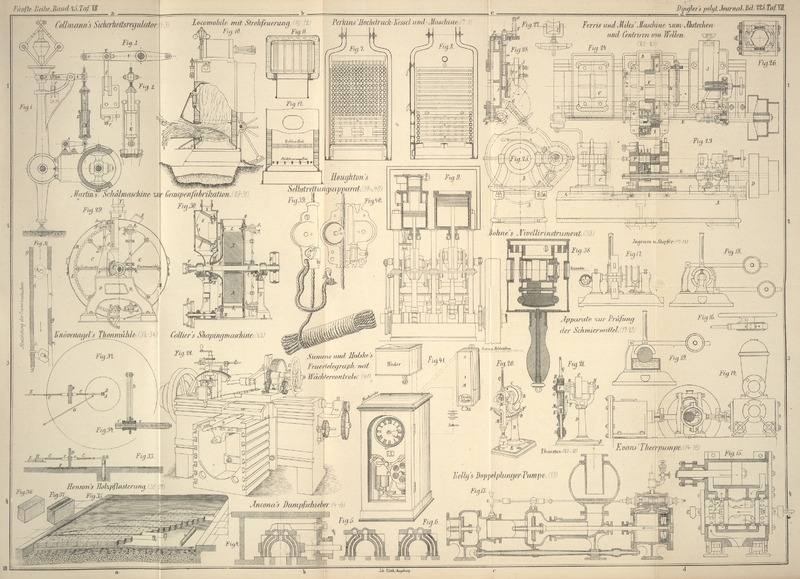| Titel: | Notizen über Mahlmühlen; nach Prof. Dr. M. Rühlmann. |
| Autor: | Moritz Rühlmann [GND] |
| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 547 |
| Download: | XML |
Notizen über Mahlmühlen; nach Prof. Dr. M. Rühlmann.
Mit Abbildungen auf Taf.
VII [a. b/2].
(Schluß von S. 441 dieses Bandes.)
Rühlmann, Notizen über Mahlmühlen.
Martin's Schälmaschine zur Graubenfabrikation u. dgl.,
welche sich überall bewährt hat, ist in Fig. 29 bis 31
dargestellt. Man erkennt, daß A der auf der Welle BB befestigte und mit dieser rotirende Stein ist,
welcher von der Bütte C umgeben wird. Letztere hat
hohle, die Steinwelle B umgebende Zapfen, deren
Lagerstellen in Figur 30 mit dem Buchstaben N und O bezeichnet sind. Die Welle B erhält ihre Drehung direct von der Antriebscheibe E, während der Büttenumlauf, wie nachbemerkt, erzeugt wird. Auf der
Verlängerung der Welle B nach links (in Fig. 30) hat man eine
sogen. Stufenscheibe F befestigt, zu welcher als passive
Scheibe eine darunter liegende F₁ gehört. Die
Welle P der letztern trägt an ihrem Ende rechts ein
Getriebe T, dessen Zähne in die eines großen Kranzes Z fassen, welcher an einer Seite der Bütte C befestigt ist. Gewöhnlich läßt man den Stein A in der Minute 240 bis 260 Umläufe machen, während die
Bütte C in derselben Zeit deren 4 1/2 bis 20 verrichtet.
Die rotirende Bütte ist mit einem unbeweglichen Mantel M
umgeben, in welchem sich Staub ansammeln kann, der bei S
(Fig. 29)
mittels eines saugenden Ventilators entfernt wird.
Die Füllung, resp. das Einlassen des Schälgutes in die Maschine geschieht aus einem
Meßkasten G, durch einen Einlauftrichter a nach dem erweiterten Büttenzapfen bei H hin. Im Füllkasten G
selbst läßt sich das Quantum des einzulassenden Schälgutes durch Erweiterung oder
Verengung des Füllraumes reguliren, wozu ein verstellbares Blech I vorhanden ist. Das rechtzeitige Ein- und
Auslassen des Schälgutes in und aus dem Füllraume G in
den Schälgang ABC wird durch zwei Walzen-
oder Drehschieber K und K₁ bewirkt, während das Entleeren des Schälgutes durch ähnliche
Drehschieber L und L₁
erfolgt. Die erforderliche Drehung dieser Schieber geschieht von der Bütte C aus mittels einer Schnecke f, Schneckenräder e und e₁ und durch Curvenscheibe g,
g₁, zu deren Verständniß noch die Detailfigur 31 gezeichnet wurde.
Die Arbeit des Füllens und Entleerens ist folgende. Durch ein Rohr Y wird alles Schälgut zuerst an den obersten
(höchstliegenden) Drehschieber K geleitet und bei der in
Figur 30
gezeichneten Stellung durch die Schieberöffnung in den Raum G geführt, bezieh. (nach gehöriger Stellung des Bleches I) in diesem Raume
abgemessen. Sobald der obere Drehschieber K geschlossen
ist, öffnet sich der untere Schieber K₁ und läßt
das Schälgut in die Bütte C treten, woselbst es dem
Abrundungsprocesse unterliegt. Während der Bearbeitung der Körner und nachdem sich
der untere Drehschieber K₁, wieder geschlossen
hat, öffnet sich der obere Drehschieber K von neuem,
worauf ein zweites Quantum Schälgut in dem Raume G
abgemessen wird und die beschriebene Arbeit neuerdings beginnt.
Ist die Bearbeitung (das Abrunden, Schälen) der Körner in gewünschter Weise und
innerhalb der festgesetzten Zeit (je nach Stellung des Riemens 1 1/2 bis 6 1/2
Minuten) geschehen, so öffnen sich die Entleerungsdrehschieber L und L₁ ebenso wie
der Speiseschieber K. Gleich nachdem sich die Schieber
L und L₁ wieder
geschlossen haben, öffnet sich der untere Drehschieber K₁ im Füllkasten G und läßt das vorher
abgemessene Mahlgut in den Gang ABC strömen.
Wie aus den Abbildungen erhellt, trägt jede Achse eines der vier Drehschieber an
einem ihrer Enden eine unrunde Scheibe h oder h₁, die ihre Bewegung von tellerförmigen Scheiben
(Curvenscheiben) g, g₁ erhalten (die in α, α₁ und β, β₁ Figur 31 abgewickelt
wurden), und zwischen welchen h oder h₁ zu gleiten, bezieh. sich zu drehen gezwungen
werden, sobald die Umdrehung der dünnen Wellen i und i₁ erfolgt, an deren Enden die Teller g, g₁ befestigt sind.
Alles weitere erhellt aus den Abbildungen von selbst.
Knövenagel's Thonmühle. Bei dem mechanischen
Durcharbeiten gewisser Thongattungen zur Fabrikation von Bauziegeln und zu andern
Zwecken bedient man sich bekanntlich auch der sogen. Fahrmaschinen, wovon früher, in
der Provinz Hannover, die eines gewissen Claußen in
Schleswig die beliebteste war und worüber u.a. in Rühlmann's Allgemeiner Maschinenlehre, Bd. 2 S. 326 (2. Aufl.) berichtet
wird. In jüngster Zeit zieht man hier jedoch der Claußen'schen Thonfahrmaschine die
des Maschinenfabrikanten A. Knövenageln Hannover
(Heinrichstraße 42) vor. Die Skizzen Fig. 32 bis 34 werden
hinreichen, Construction und Wirkungsweite der Maschine deutlich zu machen.
Mit A ist ein kräftiger, fest eingerammter Pfahl
bezeichnet, welcher nebst dem einzigen hier vorhandenen Fahrrade D, der ganzen Maschine zur Stütze dient. Am obern Ende
des Pfahles A hat man einen geeigneten Zapfen für ein
Halslager B gebildet, welches an einem Ende des
Göpelschwengels BH befestigt ist. Am äußersten
freien Schwegelende befindet sich die bekannte Spannvorrichtung E (Wage und Ortscheite) für die betreffenden Zugthiere.
Der Schwengel BH selbst besteht aus starkem
Rundeisen, und ist dessen mittlerer Theil als flachgängige Schraube CC ausgearbeitet, die ihre Mutter in der Nabe des
Fahrrades D findet. Diese Anordnung ist deutlicher in
der Detailfigur 34 zu erkennen. Der Schraube gibt man gewöhnlich 13mm Steigung bei einem Spindeldurchmesser
von 90mm. Um die Schraube vor Schmutz
möglichst zu sichern, hat man zu beiden Seiten der Radnabe cylindrische Blechhülsen
rr angebracht. G
bezeichnet die sogen. Sprengstange, deren freies Ende am Kummet- oder am
Brustriemen der eingespannten Pferde befestigt wird, um den Rundgang der Thiere
sowohl zu sichern, als zu erleichtern.
Daß, je nachdem man die bei E angespannten Thiere nach
links oder rechts umlaufen läßt, das Fahrrad D sich der
Drehachse A bezieh. nähert oder entfernt, das
beschriebene Fahrgleis also eine continuirliche Spirallinie bildet etc., versteht
sich alles wohl von selbst.
Tafeln