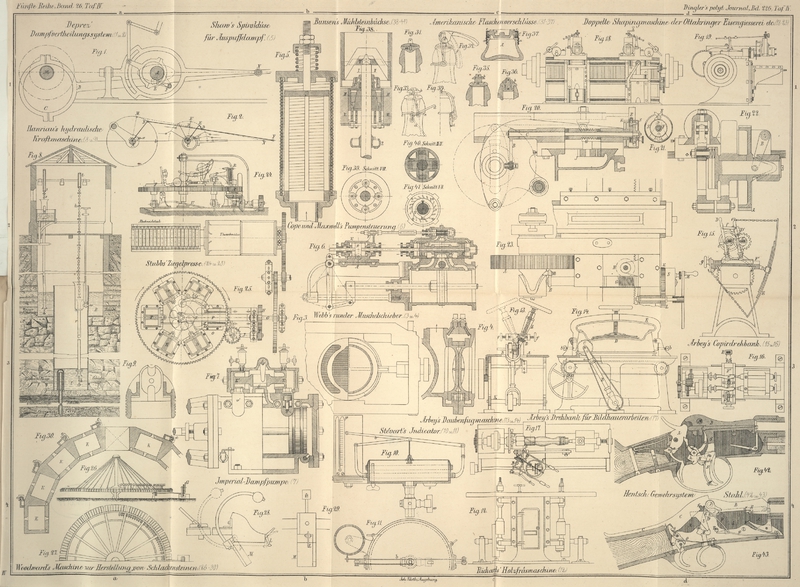| Titel: | Woodward's Maschine Herstellung von Schlackensteinen. |
| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 39 |
| Download: | XML |
Woodward's Maschine Herstellung
von Schlackensteinen.
Mit Abbildungen aus Taf. IV [a/4].
Woodward's Herstellung von
Schlackensteinen.
Auf verschiedenen englischen Werken ist seit einiger Zeit eine
Maschine in Benutzung zur Herstellung von Pflastersteinen und
Mauerziegeln aus Hohofenschlacken, verbunden mit einem Glühofen,
um den Steinen die nöthige Widerstandsfähigkeit zu geben. Der
Erfinder, Josef Woodward in
Leamington, hat mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden gehabt,
sowohl was den maschinellen Theil betrifft, als namentlich auch
in Bezug auf die Weiterbehandlung der in die Formen gegossenen
Schlackenziegeln.
Ein horizontales Rad von 6 bis 8m Durchmesser ist auf
feststehender, verticaler Achse drehbar (Fig. 26
und 27). Um
dem Ganzen die nöthige Steifigkeit zu geben, geht vom obern Ende
der Achse eine Anzahl Eisenstangen in gleichen Abständen bis zum
Radumfang; in letzteren sind die gußeisernen Formkästen (Fig.
28 und 29) mit
beweglichem Boden eingesetzt. Ihre Größe und Gestalt richtet
sich nach der Art der herzustellenden Steine. Das Formrad, fast
ganz aus gewöhnlichem T-Eisen
construirt, wird durch ein Handrad G
mit Vorgelege in Bewegung gesetzt und ist so aufgestellt, daß
die von der Schlackenrampe herablaufende Schlacke unmittelbar in
die einzelnen Formkästen fliehen kann. Nach 1/4 Umdrehung des
Rades ist die Schlacke in der Form gewöhnlich äußerlich erstarrt
und so weit abgekühlt, daß man den Boden der betreffenden Form
durch Andrücken an die Klinke L
öffnen und den gebildeten Schlackenstein aus der Form fallen
lassen kann; die Bodenklappe schließt sich alsdann in Folge des
angebrachten Gegengewichtes von selbst. Der Schlackenstein wird
sodann durch einen Arbeiter mit einer dreizackigen Gabel
aufgehoben und in den concentrisch im Kreis um das Formrad
liegenden Glühofen (Fig. 30)
gebracht.
Der Glühofen enthält die Kammern K
zur Aufnahme der Schlackensteine und wird durch
Kohle oder, wie hier angedeutet, durch Hohofengase unter
Anwendung von Gebläsewind erhitzt. Die Gase werden durch eine
Rohrleitung, welche nach jeder einzelnen Kammer eine
verschließbare Abzweigung c hat,
herangeführt. Vor dem Einbringen der Schlackensteine erhitzt man
die Kammern bis auf Weißglut, legt sodann die Schlackensteine
ein, bedeckt und verschmiert die Kammern und unterhält die Hitze
4 Stunden lang. Hierauf sperrt man das Gas ab und läßt langsam
erkalten.
Die auf diese Weise erhaltenen Steine sehen gut aus, sind mehr
oder weniger scharfkantig, mit ebenen Flächen, ohne dabei glatt
zu sein. In Stockton-on-Tees, Darlington u.a. wurden sie als
Pflastersteine benutzt und erwiesen sich selbst bei schweren
Lasten als dauerhaft und sehr wenig dem Verschleiß unterworfen;
das darüber gehende Fuhrwerk macht nicht viel Geräusch, und
werden die Steine durch den Gebrauch nicht schlüpferig. Das
specifische Gewicht beträgt 2,69, die Zerdrückungsfestigkeit
etwa 620k auf 1qc. Woodward gibt an, daß er einen weißglühenden
Schlackenstein aus dem Glühofen direct in kaltes Wasser geworfen
habe, ohne daß der Stein dadurch im Geringsten beschädigt worden
wäre. (Nach dem Engineer, Juli 1877 S. 11 und
25.)
Es ist einleuchtend, daß die Dauerhaftigkeit solcher Steine von
der Zusammensetzung der Schlacke abhängt, und daß man bei
Auswahl der als Baumaterial zu verwendenden Schlacke, wenn
dieselbe ohne fremde Beimengungen gebraucht werden soll, sehr
vorsichtig sein muß. (Vgl. 1872 206
457. *1873 208 292.)
–r.
Tafeln