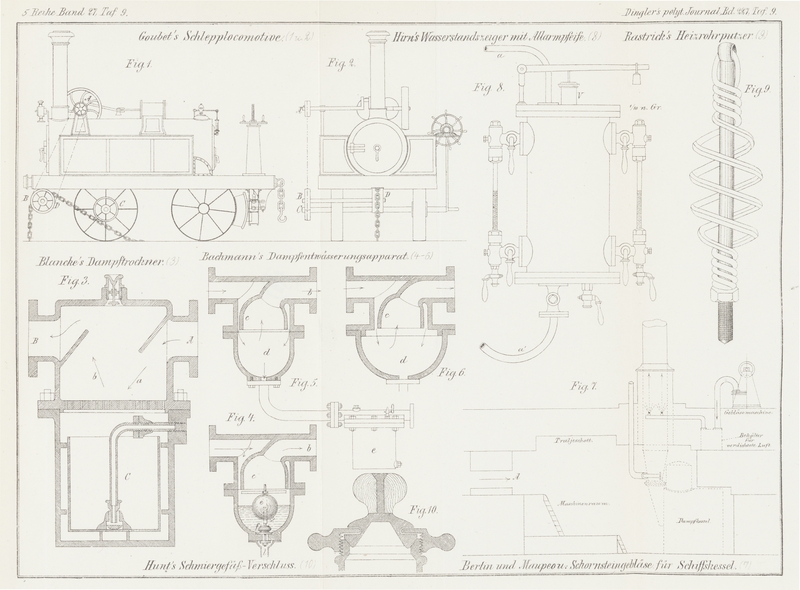| Titel: | Ueber zwei neue Dampfentwässerungsapparate. |
| Autor: | A. H. C. Bachmann |
| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 123 |
| Download: | XML |
Ueber zwei neue
Dampfentwässerungsapparate.
Mit Abbildungen auf Tafel
9.
Bachmann, über Dampfentwässerungsapparate.
Seit einiger Zeit verfertigt die Maschinenfabrik C. W. Julius
Blancke und Comp. in Merseburg den in Fig. 3 Taf. 9
dargestellten „Dampftrockner verbunden mit Condensationswasserableiter“. Der
Dampf und das Condensationswasser treten bei A ein,
letzteres fliesst durch ein Sieb in den unteren Theil des Apparates und wird daraus
stossweise abgeführt; der trocken gewordene Dampf entweicht bei B zur Speisung der Maschine.
Ich kann nicht unterlassen, etwas näher auf diesen Apparat einzugehen, da das
Entwässern des Dampfes doch nicht in der angegebenen Weise stattfinden kann und die
Behauptung, dass der Dampf der Maschine trocken zugeführt werde, nach meiner Ansicht
eine irrige ist.
Die mitgerissenen Wasserbläschen werden grösstentheils bei schnellem Dampfeintritt,
dem Pfeile a (Fig. 3) folgend, die
Siebfläche treffen, und ein grosser Theil derselben wird in der Richtung des Pfeiles
b abspringen. Es tritt dabei wieder eine Auflösung
und Mengung mit dem getrockneten Dampfe ein, da die Geschwindigkeit beim Austritt
fast gleich ist der beim Eintritt. Die Siebfläche bildet ausserdem eine ziemlich
starke Decke, welche eine ansehnliche Wärmemenge aufzunehmen im Stande ist, so dass
von den an ihr haftenden Wassertheilchen eine nicht unbeträchtliche Menge wieder in
feuchten Dampf verwandelt wird. Auch die im Topf C
unmittelbar angesammelte Wassermenge schädlich, da von ihr feuchte Dämpfe stets
wieder durch das Sieb steigen und sich mit dem vom Wasser nothdürftig befreiten
Dampfe mischen können.
Mein Entwässerungsapparat, der in seiner ursprünglichen Form in Fig. 4 Taf. 9 abgebildet
ist (vgl. *1875 218 92), gab in dieser Gestalt in Rosslau a. d. Elbe sehr
befriedigende Resultate. Der nass eintretende Dampf stürzt hier über die Glocke c in senkrechter Richtung, und der vom Wasser befreite
Dampf kann mit gemässigter Geschwindigkeit zunächst unter die Glocke treten, um dann
bei b mit normaler Schnelligkeit zur Verbrauchsstelle
zu entweichen. Der Schwimmer e öffnet und schliesst je
nach der Wasseransammlung ein entlastetes Ventil f, und
das Wasser wird bei l abgeleitet.
Die Maschinenfabrik von Dreyer, Rosenkranz und Droop in
Hannover, welche meine Apparate herstellt, hat nach gesammelten Erfahrungen die
Ausführung zweckmässig dahin umgeändert, dass der Schwimmer und das Ventil im
unteren Theile des Topfes weggelassen sind, dafür aber entfernt vom Apparat ein
kleiner Condensationswasserableiter e (Fig. 5) aufgestellt ist.
Es sammelt sich somit in dem unteren Topfe d gar kein
Wasser, die Bildung und Aufnahme feuchter Dämpfe ist somit vermieden und verdirbt
den einmal vom Wasser befreiten Dampf nicht wieder.
Um auch die Verdunstung, welche an den Wandungen stattfindet, besser zu verhindern,
führt die genannte Firma den unteren Topf d jetzt etwas
grösser aus, wie in Fig. 6 skizzirt, so dass die Wassertheilchen nicht unmittelbar an den
Wänden herabfliessen.
A. H. C.
Bachmann.
Tafeln