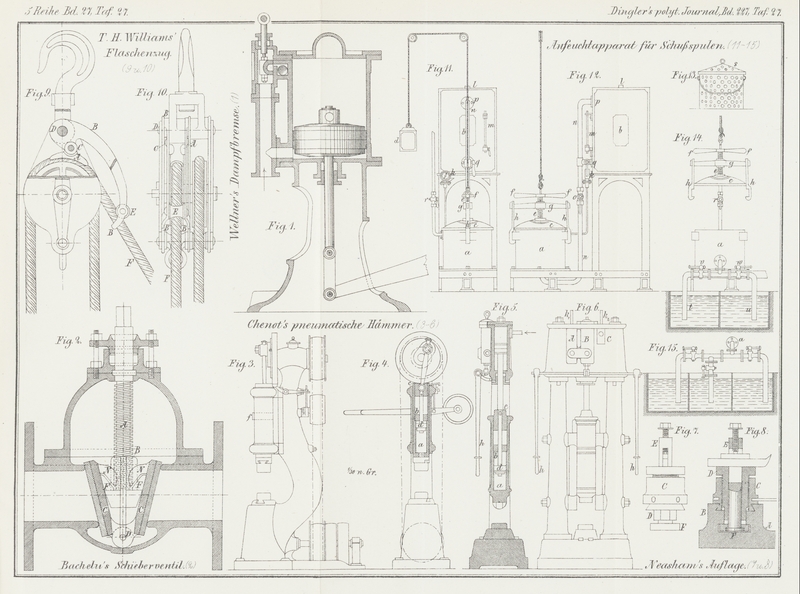| Titel: | Anfeuchtapparat für Schussspulen. |
| Autor: | E. L. |
| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 434 |
| Download: | XML |
Anfeuchtapparat für Schussspulen.
Mit Abbildungen auf Tafel
27.
Anfeuchtapparat für Schussspulen.
Um die Schussfäden weicher, nachgiebiger zu machen, sie fester und dichter
einschlagen zu können, verwebt man Wollen-, Baumwollen- und auch Leinengarn oft in
feuchtem Zustande. Der feuchte Schussfaden löst die Schlichte oder den Leim der
Kettenfäden, so dass das Zurückdrängen des Schusses durch die Kette wesentlich
herabgezogen wird und man in vielen Fällen eine glattere und dichtere Waare erhält,
als es sonst der Fall wäre. Für Wolle ist Seifenwasser empfehlenswerth. Es macht das
Garn schlüpfrig und ergeben damit angefeuchtete Spulen bei dem Verweben weniger
Garnverlust.
Selbstverständlich ist es eine Hauptbedingung für die Herstellung einer vollständig
gleichmässigen Waare, dass die sämmtlichen Schussspulen und ebenso der volle Faden
einer jeden einzelnen Spule gleichmässig angefeuchtet werden. Macht man das Garn im
Strähn vor dem Verspulen nass, oder legt die Spulen einfach in das Anfeuchtwasser,
so ist den Arbeitern zu viel Willkür gelassen und eine ganz verschiedenartige
Anfeuchtung unvermeidlich. Nach dem Nässen folgendes Spulen macht, je nachdem es
schneller oder langsamer, fester oder lockerer erfolgt, die Anfeuchtung des Garnes
ebenso verschiedenartig. Einlegen in Wasser ergibt eine langsame und insofern eine
sehr ungleichmässige Anfeuchtung, als sich die äusseren Garnschichten schneller wie
die innern vollsaugen. Selbst nachfolgendes Schleudern ist nicht im Stande, die
Ungleichmässigkeiten wieder auszugleichen.
Das Gesagte veranlasste die Construction von Anfeuchtapparaten, Welche das Nässen
schnell und gewaltsam bewirken; ebenso hat man Trockenapparate eingeführt, welche
das zu viel angesaugte Wasser so entfernen, dass die Anfeuchtung durch und durch
eine gleichmässige ist. Man drückt z.B. das Wasser mit Zuhilfenahme einer Druckpumpe
in die Spulen, oder saugt es mittels einer Saugpumpe durch sie hindurch, oder saugt
die Luft aus den Spulen zuerst heraus und führt ihnen alsdann Wasser zu. Das
Trocknen hat man ebensowohl durch überhitzten Dampf als auch durch Ausschleudern
bewirkt.
Der in Nachfolgendem beschriebene und bereits in grösseren Webereien im Elsass in
Benutzung gekommene Apparat drückt das Wasser mittels Dampfdruck in das Garn hinein
und treibt das überflüssige durch Dampf auch wieder aus, oder er stellt durch
Dampfcondensation möglichste Luftleere her und lässt diese in die in ihr liegenden
Spulen Wasser ansaugen.
1) Eindrücken des Wassers durch natürlichen und durch
Dampf-Druck (Fig. 11 bis 13 Taf. 27).
Auf einem eisernen Gestell sind zwei Gefässe befestigt, a unten als Anfeuchtgefäss und b oben als
Wasserbehälter. Das Gefäss a ist durch einen Deckel c dicht zu schliessen, ebenso leicht aber auch zu
öffnen. Zu diesem Zwecke ist c durch ein Gewicht d ausbalancirt und mit einer Schraubenspindel e verbunden, welche durch Handgriffe f leicht gedreht werden kann und hierbei einen Bügel
g mit anhängenden Haken h hebt oder senkt. Schraubt man bei geschlossenem Deckel den Bügel g etwas nieder, so werden die Haken h gelockert und lassen sich von a abheben; es genügt alsdann ein leichtes Hochziehen des Seiles, um den
Niedergang von d und den Hochgang des Deckels c zu bewirken. Umgekehrt erfolgt der Verschluss von a ebenso bequem. Das Gefäss a ist so stark, um einem Druck von 3 bis 4at welcher durch das Manometer k angezeigt
wird, sicher zu widerstehen. Der Behalter b ist ein von
allen Seiten geschlossener Kasten, der oben bei l mit
einem sich nach aussen öffnenden Luftventil und seitlich bei m mit einem
Wasserstandzeiger versehen ist. Durch eine Rohrleitung n mit Absperrhahn o stehen a und b mit einander in VerbindungVerbinduug. Diese Rohrleitung mündet in a am Boden ein,
in b hingegen ebensowohl oben bei p als unten bei q.
Letztere Abzweigung ist durch einen Hahn absperrbar.
Das Verfahren ist folgendes: Man öffnet a, füllt es mit dem Anfeuchtwasser, schliesst
hierauf a und drückt das Wasser nach b; letzteres erfolgt dadurch, dass man die Hähne o und q, sowie den Hahn
r des oben in a
einmündenden Dampfzuleitungsrohres öffnet. Jetzt schliesst man die Hähne q und r, öffnet das Gefäss
a und setzt in letzteres die zu nässenden Spulen
ein, welche zuvor in einen durchlochten Weissblech- oder Zinkblechtopf s (Fig. 13) eingelegt
wurden. Hierauf öffnet man den Hahn q, so dass das in
dem Behälter b befindliche Wasser durch die Rohrleitung
n in a tritt. Ist das
Wasser bis zur obern Kante des Spulengefässes heruntergelaufen, so schliesst man o und Gefäss a, öffnet den
Dampfhahn r und lässt Dampf in a treten, bis das Manometer k 2at,5 Spannung anzeigt. Diesen Druck lässt man 2
bis 3 Minuten in a wirken. Der Dampf erhitzt und drückt
das Wasser in die Spulen, treibt die darin befindliche Luft aus und durch nässt das
Garn vollständig. Alsdann öffnet man vorsichtig den Hahn o; der Dampf treibt in nahezu 1 Minute das Wasser aus a durch n nach b zurück. Ist dies erfolgt, so schliesst man o und r, öffnet a und nimmt die Spulen heraus. Hierauf setzt man einen
zweiten mit trockenen Spulen gefüllten Topf s in a ein und wiederholt die vorige Arbeit.
Nimmt man an, dass ein geübter Arbeiter zu dem Anfeuchten einer Topffüllung im
Gewichte von 15 bis 16k etwa 4 bis 5 Minuten Zeit
nöthig hat, so kann er in der Stunde etwa 190k,
also in 12 Stunden fast 2000k Schussspulen nässen,
wobei er alle 2 Stunden einmal das Anfeuchtwasser in a
frisch einzugeben hat. Es ist demgemäss die Leistung des Apparates den andern
gegenüber eine sehr grosse. Fasst das Gefäss a 70l Wasser, so erfordert ein solcher Apparat an
Raum: Länge = 1m,4, Breite = 0m,625 und Höhe = 1m,9.
Kleinere Details der beschriebenen Anfeuchtapparate hat man auch noch in etwas
anderer Weise ausgeführt, z.B. das obere Gefäss b durch
einen lose aufgelegten Deckel geschlossen, um in dasselbe nach Abhebung dieses
Deckels das Wasser bequem eingiessen zu können, und zum Auslassen der Luft an dem
Deckel c einen Lufthahn angebracht. Ebenso hat man das
Gegengewicht für den Deckel c und Zubehör dadurch beseitigt, dass man am
Untergestell von b eine stehende Drehachse anbrachte,
die mit einer unterhalb g auf e aufgesteckten Büchse in Verbindung steht. Dreht man die Schraubenspindel
e zurück, so senken sich zunächst der Bügel g und die Haken h, so dass
man letztere von a abhängen kann. Bei fortgesetzter
Rückwärtsdrehung setzt sich der Bügel auf die Büchse auf und der Deckel c wird abge-
hoben. Um den Topf
a ganz zugänglich zu machen, wurde die Büchse mit
dem daran hängenden Deckel u.s.w. um die stehende Drehachse zur Seite gedreht. Zur
Entleerung des Behälters b ist oft an dessen Boden ein
Ablasshahn angebracht.
2) Ansaugen des Wassers in die Spulen (Fig. 14 und 15 Taf. 27).
Diese Einrichtung hat Victor Schlumberger an einem
Apparat der zuerst beschriebenen Construction getroffen. Sie soll namentlich zur
wechselweisen Verwendung verschiedener Seifenwässer dienen und den Apparat dabei
immer noch sehr leistungsfähig und bequem für die Bedienung lassen. Man bringt das
Anfeuchtwasser in Cisternen. Fig. 14 zeigt zwei
derselben bei t und u.
Fig. 15
gibt deren drei Stück an. Vom Boden des Gefässes a aus
zweigt in diese Cisternen eine mittels Hahn absperrbare Rohrleitung ab.
Ist das Gefäss a geschlossen und sind die Hähne o und hierauf r (Fig. 11 und
12)
geöffnet worden, so wird bei Offenhaltung eines der Hähne v oder w (Fig. 14) das Wasser in
t oder in u erwärmt.
Nach Verlauf einer Minute, während welcher der Dampf alle in a und in den Rohrleitungen befindliche Luft ausgetrieben hat, schliesst
man schnell die Hähne o und r. Es wird jetzt Condensation in a eintreten
und das Seifenwasser in das Spulengefäss hinaufgetrieben. Ein Schwimmer o, dgl. in den Cisternen gibt an, wann die
grösstmögliche Menge Wasser nach a getreten ist.
Alsdann schliesst man schnell den vorher offenen Hahn v
oder w und lässt die Flüssigkeit in a wirken, welche nun sehr leicht in die luftleeren
Spulen eindringt und sie vollständig nässt.
Um die genässten Spulen herauszunehmen, öffnet man die Hähne v oder w und den Topf a. Das Wasser läuft nach t oder u zurück, ein neuer Spulenbehälter kann eingesetzt, a sofort wieder geschlossen und das Spiel wiederholt
werden. Das einzige Missliche hierbei ist, dass das Wasser nicht zu warm werden
darf, weil es sonst nicht nach a aufzeigt. Mit Hilfe
von mehr als zwei Cisternen aber, z.B. drei, wie in Fig. 15 gezeichnet, kann
man diesem Uebel abhelfen. Eine Maschine mit drei Cisternen soll nach Schlumberger für 500 Stück mechanische Webstühle
vollständig den Bedarf an Schuss liefern. (Nach dem Bulletin de
Mulhouse, 1877 S. 357.)
E. L.
Tafeln