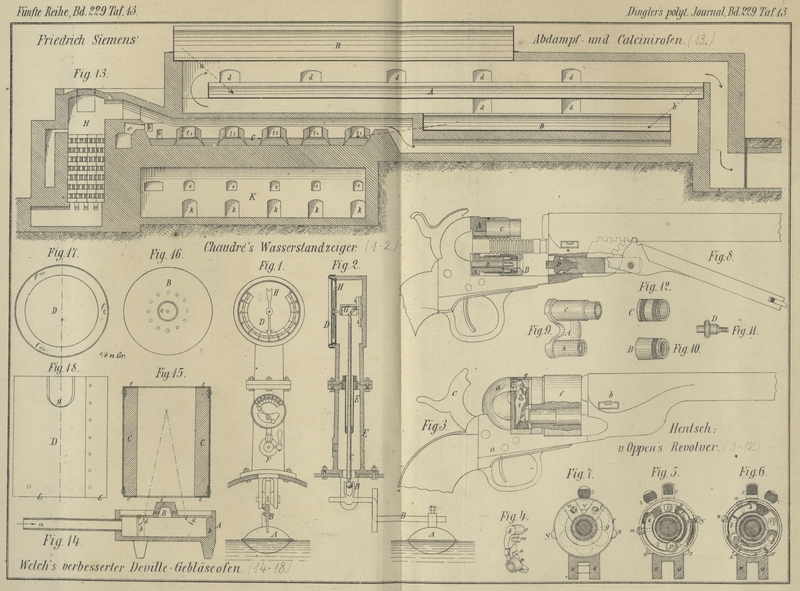| Titel: | Eine verbesserte Form des Deville'schen Gebläseofens; von J. G. H. Godfrey in London. |
| Autor: | J. G. H. Godfrey |
| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 159 |
| Download: | XML |
Eine verbesserte Form des Deville'schen
Gebläseofens; von J. G. H.
Godfrey in London.
Mit Abbildungen auf Tafel 13.
Godfrey, über Welch's verbesserten Gebläseofen.
In neuerer Zeit hat Ch. Welch (67 Pattison Road,
Plumstead Kent) die gebräuchliche Construction des Deville'schen
Gebläseofens verbessert und dadurch solche wesentliche Vortheile erzielt, daſs diese
verbesserte Construction auch in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient.
Der Ofen (Fig. 14 bis
18 Taf. 13) besteht aus einem guſseisernen Gestell A, einer runden schmiedeisernen Scheibe B und einem mit feuerfestem Thon ausgekleideten
Blechcylinder C. Die schmiedeiserne Röhre a dient zur Einführung des Windes, die Scheibe B kommt auf die drei Ansätze b zu liegen; der conische Vorsprung c dient
als Unterlage für die Tiegel und ist zur Kühlerhaltung mit vier 1mm,5 weiten runden Löchern versehen – eines in der
Mitte der oberen Fläche und drei in den Seitenwänden. Die Scheibe B hat noch 12 runde Löcher, welche den Wind in den
durch den Cylinder C gebildeten eigentlichen Ofen einführen. Diese Löcher
sind 5mm weit und so gebohrt, daſs ihre Achsen in
einem etwa 18cm von der oberen Scheibenfläche
entfernten Punkte zusammentreffen. Der feuerfeste Thon wird in dem Cylinder C noch durch zwei an dieser Peripherie angenieteten
Ringe e zusammengehalten. Der Cylinder C paſst gerade in das Innere des Gestelles A; ein gröſserer Ofen kann dadurch erhalten werden,
daſs man einen gröſseren und weiteren Cylinder D auf
den äuſseren Ring des Gestelles aufsetzt. Dieser Cylinder D hat dann am unteren Ende drei kleine Ansätze f, welche eine seitliche Verschiebung desselben verhüten; auſserdem kann
derselbe noch mit einem Ausschnitt g versehen werden,
welcher bei der Anstellung von Destillationsversuchen von Nutzen ist. Sonst ist
dieser gröſsere Cylinder D ganz wie der kleinere C construirt.
Beim Gebrauche des Ofens wird über den Ansatz c ein umgekehrter Tiegel etwa 45mm hoch gestülpt und auf diesen kommt dann der
eigentliche, etwa 8cm hohe, französische oder
„Cornish“-Tiegel zu stehen. Als Brennmaterial dienen Kokesstücke von 1
bis 2cm Durchmesser. Beim Anfeuern des Ofens wird
die Röhre a mit einem doppelt wirkenden Blasebalg
verbunden. Mit der nöthigen Sorgfalt kann man in dem Zeiträume von 20 Minuten, vom
Anfeuern an gerechnet, in dem kleinen Ofen eine Charge von 120g Schmiedeisen in vollständigen Fluſs bringen. Es
ist hierdurch ersichtlich, daſs die Concentration der Windströme auf einen gut
gewählten Punkt die Leitungsfähigkeit des Deville'schen
Gebläseofens bedeutend erhöht.
Tafeln