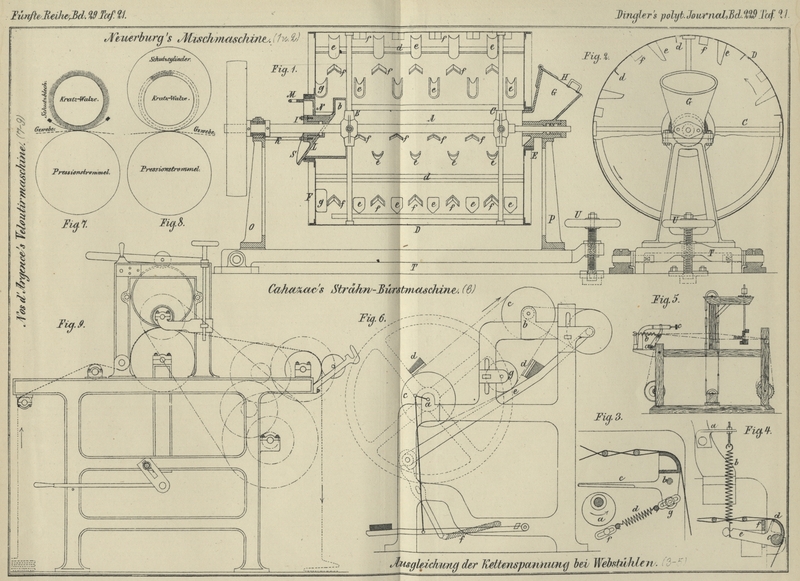| Titel: | Nos d'Argence's Maschine zum Aufreissen von Mustern auf Geweben (Veloutirmaschine). |
| Autor: | Kl. |
| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 253 |
| Download: | XML |
Nos d'Argence's Maschine zum Aufreiſsen von Mustern auf Geweben
(Veloutirmaschine).
Mit Abbildungen auf Tafel 21.
Nos d'Argence's Veloutirmaschine.
Um auf glatten oder croisirten, rohen, gefärbten oder bedruckten Geweben von Wolle
oder Baumwolle erhabene oder vertiefte Stoffzeichnungen hervorzubringen, hat Nos d'Argence eine Maschine erfunden, welche zur Zeit
von F. Delamare-Deboutteville auf der Pariser
Ausstellung vorgeführt (vgl. S. 13 d. Bd.) und in Fig. 7 bis
9 Taf. 21 näher veranschaulicht ist.
Das Aufreiſsen der Fäden des Gewebes geschieht mittels kupferner oder eiserner
Kratzen mit sehr langen, biegsamen, nicht sehr dichten Häkchen, welche auf einer
horizontalen, rasch umlaufenden Walze aufgezogen sind, während das Gewebe unter der
Veloutirwalze sich fortbewegt, so daſs es fortwährend und unter immer gleichem Druck
von den Kratzen angegriffen wird. Es gelingt auf diese Weise, dem ganzen Gewebe ein
sammetartiges Aussehen zu geben. Um diesen Effect nur an einzelnen Stellen des
Gewebes hervorzubringen, hat der Erfinder zwischen der Kratzwalze und dem Gewebe ein
dünnes, kammartig durchbrochenes Metallblech angebracht; die Ausschnitte in
letzterem entsprechen dem aufzureiſsenden Muster, während die Blechfläche den Theil
des Gewebes vor der Einwirkung der Kratzen schützt, welcher seine ursprüngliche
Dichte und sein Ansehen beibehalten soll. Soll das Muster einen fortlaufenden
Längsstrich vorstellen, so ist das Schutzblech unbeweglich und hat die Form eines
Cylindersegmentes (Fig. 7),
innerhalb dessen die Kratzwalze sich dreht. Sollen unterbrochene, in beliebiger
Richtung auf dem Gewebe vertheilte Muster hervorgebracht werden, so erhält das
durchbrochene Schutzblech die Form eines vollständigen Cylinders (Fig. 8). Die
Kratzwalze dreht sich innerhalb dieses Schutzcylinders, letzterer dreht sich
unabhängig und mit geringerer Geschwindigkeit als die Kratzwalze, aber gleich
schnell wie das unter ihm hinlaufende Gewebe.
In beiden Fällen wird das Gewebe durch einen Preſsionscylinder gegen die Kratzwalze
angedrückt; der erstere dreht sich in der Richtung und mit der Geschwindigkeit des
Gewebes. Um die aufgerissenen Stellen, insbesondere bei Wollstoffen, gleichzeitig zu
rauhen, ist der Kratzwalze auſser der Drehung um ihre Achse noch eine horizontale
hin- und hergehende Bewegung gegeben. Zur weiteren Verdeutlichung der Maschine dient
die in Fig. 9 gezeichnete Seitenansicht derselben. Hierbei ist der Fall
angenommen, daſs die Kratzwalze von dem sich mitdrehenden Schutzcylinder ganz
umschlossen ist. Das Gewebe geht über Leitwälzchen, zwischen dem Schutzcylinder
bezieh. der Kratzwalze und der Preſsionstrommel durch und rollt sich auf einer von
Zahnrädern und Scheiben getriebenen Walze auf oder wird in bekannter Weise einfach
abgelegt. Die Kratzwalze erhält von der Triebscheibe eine Geschwindigkeit von 300
Umdrehungen in der Minute; ihre Lager befinden sich auf zwei mittels einer Schraube
von unten nach oben beweglichen, horizontalen Seitenbacken, um die Kratzen beliebig
gegen den durchbrochenen Schutzcylinder und das Gewebe andrücken zu können. Auch die
Preſsionstrommel ruht in beweglichen Lagern auf zwei senkrechten Seitenbacken;
letztere stehen auf dem abgerundeten Ende eines Hebels, gehen mit der Bewegung
desselben in einer Gleitschiene beliebig auf und ab und bestimmen so den Druck der
Preſsionstrommel gegen das durchlaufende Gewebe und gegen die Kratzwalze. Der
Schutzcylinder hängt frei im Oberständer zwischen fest gelagerten, sowie zwischen
einer obenauf mittels Hebel beweglichen Leitrolle, um dergestalt beliebig dem Gewebe
genähert oder von demselben entfernt werden zu können. Beide Cylinder, sowohl der
Schutzcylinder als die Preſsionstrommel, erhalten ihre Bewegung vom durchlaufenden
Gewebe. Das Obergestell kann umgeklappt werden, wenn das Muster bezieh. der
Schutzcylinder gewechselt werden soll.
Eine solche Maschine bearbeitet minutlich im Mittel 1,5 bis 1m,8 Waare oder 1000 bis 1200m im Tag. Die Instandhaltung derselben verursacht
keine besonderen Kosten, mit Ausnahme der Kratzen, welche freilich sehr oft
geschärft werden müssen und sich ungemein rasch abnutzen. Die selbstverständlich
erforderliche Schutzvorrichtung gegen den entstehenden Staub ist in unseren Figuren
nicht angedeutet; ebenso wenig der einfache Mechanismus zur horizontalen Hin- und
Herschiebung der rotirenden Kratzwalze.
Kl.
Tafeln