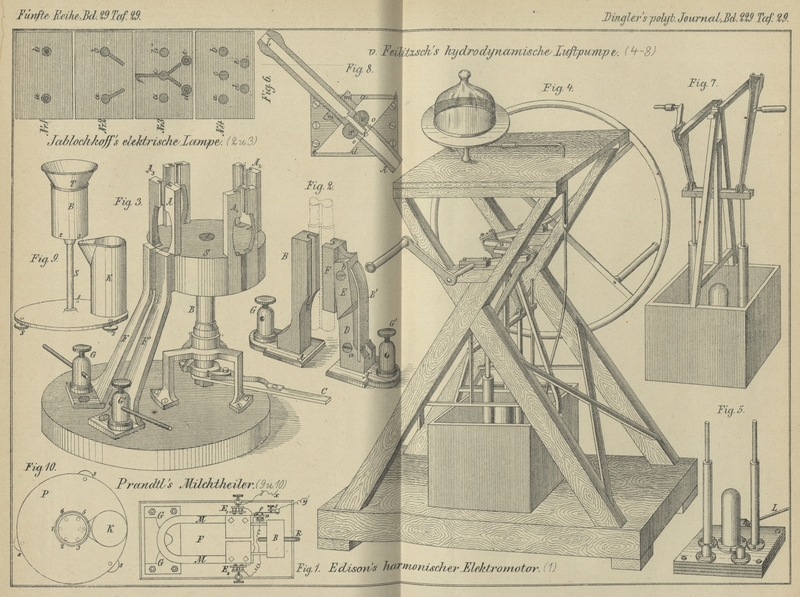| Titel: | P. Jablochkoff`'s elektrische Lampe. |
| Fundstelle: | Band 229, Jahrgang 1878, S. 335 |
| Download: | XML |
P. Jablochkoff`'s elektrische Lampe.
Mit Abbildungen auf Tafel 29.
Jablochkoff`'s elektrische Lampe.
Fig.
2 und 3 Taf. 29
zeigen die Einrichtung, in welcher P. Jablochkoff seine
elektrische Lampe (vgl. 1877 223 221) *1878 227 159. D. R. P. Nr. 663 und 1630 vom 14. August 1877. Nr. 1638 vom 31.
October 1877) kürzlich bei den in Gemeinschaft mit Denayrouze an der Façade des neuen Opernhauses in Paris angestellten
Versuchen benutzt hat.
Fig.
2 stellt den gewöhnlichen Leuchter zur Aufnahme der punktirt gezeichneten
elektrischen Kerze vor. Zwei messingene Halter B, B'
sind auf zwei Trägern von gleichem Metall A, A'
befestigt, welche auf einer isolirenden Substanz (Hartgummi, Elfenbein etc.) ruhen
und zugleich die Klemmschrauben G, G' zur Aufnahme der
Leitungsdrähte tragen. Der Halter B steht fest, während
der Backen F um den Zapfen b drehbar ist. An dem unteren Theil D
befindet sich eine starke Feder, welche gegen den oberen Theil E drückt, der sich in einem Gelenk a bewegt. Es ist durch diese Einrichtung die parallele
Stellung der beiden Kerzenhalter gesichert, was zum leichten Uebergang der
Elektricität auf die Kohlen erforderlich ist. Auſserdem können Kerzen von beliebiger
Form in dem Halter befestigt werden.
Fig.
3 zeigt die Einrichtung für vier Kerzen, welche mit nur momentaner
Unterbrechung nach einander mit dem elektrischen Strom verbunden und so zum Leuchten
gebracht werden können. Eine Scheibe S aus Hartgummi
trägt vier kupferne Hülsenpaare A bis A3 zur Aufnahme
elektrischer Kerzen. Die Hartgummischeibe sitzt auf einer kupfernen Achse B, die mittels des Hebels C gedreht werden kann. Hierdurch kann jedes Hülsenpaar in leitende
Verbindung mit den Federn F, F' und durch die
Klemmschrauben G, G' mit den Zuleitungsdrähten gebracht
werden. Ist eine Kerze verbraucht, so wird durch Auflegen eines Kupferstreifens auf
die Federn F, F' die Kerze ausgeschaltet und nun die
Scheibe S mittels des Hebels C rasch um eine Viertelumdrehung verschoben. Dadurch gelangt eine neue
Kerze an die Contactfedern F, F' und wird nach
Entfernung des verbindenden Kupferstreifens entzündet. – Jablochkoff und Denayrouze sollen einen
Apparat construirt haben, welcher das Auswechseln der Kerze selbstthätig bewirkt.
(Nach La semaine des constructeurs durch das Journal für Gasbeleuchtung etc., 1878 S. 99.)
Auf der Pariser Ausstellung befindet sich nach Engineering, 1878 Bd. 26 S. 63 die elektrische Lampe
oder Kerze von P. Jablochkoff in einem besonderen
Pavillon. Bei ihrer Verwendung mit dynamo-elektrischen Maschinen mit
gleichgerichteten Strömen ist der Strom in Zwischenräumen von einigen Secunden
umzukehren, was einen Kraftverlust veranlaſst. Besser verwendet man daher
elektromagnetische Maschinen, welche Wechselströme liefern. Gramme hat dazu seine Maschine etwas umgestaltet, so daſs deren
Wechselströme für 4 bis 16 Kerzen ausreichen. Mit ihr werden allnächtlich etwa 300
elektrische Lichter zur Beleuchtung der Boulevards und der öffentlichen Gebäude in
Paris unterhalten. Die Bewicklung dieser Maschine besteht aus 8 Theilen, deren
Wickelungsrichtung von Theil zu Theil abwechselt. Im Innern dieses festliegenden
Ringes läuft ein aus 8 Elektromagneten gebildeter Stern um, welche durch eine
Batterie oder eine kleine Gramme'sche Maschine
magnetisirt werden und in ihren dem Ringe zugekehrten, verbreiterten Polen
abwechselnd verschiedene Polarität besitzen. Jede Abtheilung des Ringes besteht
wieder aus 4 Abtheilungen a bis d; in allen S Unterabtheilungen a
hat der Strom die
nämliche Richtung, ebenso in allen Unterabtheilungen b,
c und d. Will man also blos 4 Kerzen speisen,
so vereinigt man für die eine die sämmtlichen Unterabtheilungen a, für die drei andern die Unterabtheilungen b, c und d. Die gröſste
dieser Maschinen reicht für 16 Kerzen aus, macht 600 Umdrehungen und braucht 16e; sie kostet nebst den kleineren Maschinen zur
Magnetisirung ihrer Elektromagnete 8000 M.; die kleinste macht 800 Umläufe, braucht
4e und speist 4 Kerzen.
Die Einführung der Jablochkoff'schen
Kerzen in Deutschland haben Siemens und Halske in
Berlin übernommen. Am 6. August d. J. Abends erleuchteten sie mittels 16 in den
Höfen und mehreren Arbeitssälen ihrer Fabrik vertheilten Lampen in höchst
befriedigender Weise diese Räume. Den Strom lieferte eine magneto-elektrische
Maschine, deren Elektromagnete durch eine Siemens und
Halske'sche dynamo-elektrische Maschine (v. Hefner's System) magnetisirt wurden. Der Arbeitsverbrauch betrug etwa
12e, einschlieſslich des Arbeitsverbrauches
der magnetisirenden Maschine. Die hierbei benutzten neuen Maschinen von Siemens und Halske für Wechselströme unterscheiden sich
von den Gramme'schen und allen anderen bisher zur
Verwendung gekommenen sehr wesentlich dadurch, daſs bei ihnen nur Drahtwindungen
ohne Eisenkerne inducirt werden, wodurch viel Kraft gespart und die Erwärmung der
Maschine verringert wird.
Tafeln