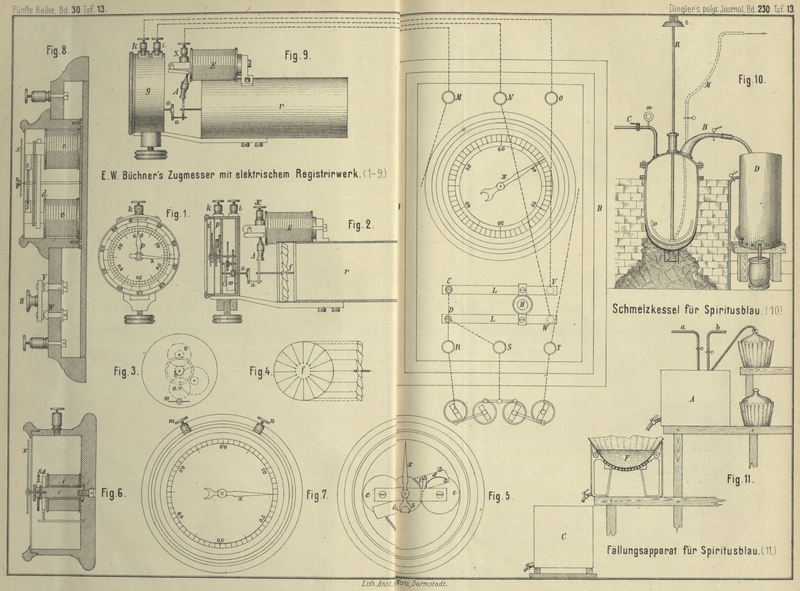| Titel: | E. W. Büchner's Zugmesser mit elektrischem Registrirwerk. |
| Autor: | F. H. |
| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 131 |
| Download: | XML |
E. W. Büchner's Zugmesser mit elektrischem
Registrirwerk.
Mit Abbildungen auf Tafel 13.
Büchner's Zugmesser mit elektrischem Registrirwerk.
Es ist in vielen Fällen unbequem, die Beobachtungen bei Zugmessungen an Ort und
Stelle zu machen, noch dazu mit Apparaten, welche an und für sich complicirt und
unhandlich sind. Es dürfte deshalb für manche Zwecke ein neuer, von Dr. E. W. Buchner in Pfungstadt bei Darmstadt patentirter
Zugmesser (D. R. P. Nr. 1741 vom 25. December 1877) willkommen sein, welcher mit
groſser Einfachheit und Empfindlichkeit den Vortheil verbindet, daſs die Angaben des
Zählwerkes durch eine elektrische Leitung auf einen beliebigen Ort übertragen werden
können, von welchem aus dann auch der Zugmesser selbst nach Willkur in Gang gesetzt
und abgestellt werden kann.
Der auf Taf. 13 Fig. 1 bis
3 abgebildete Zugmesser besteht aus einem leicht beweglichen
Flügelrädchen f (in Fig. 4
besonders herausgezeichnet), welches in ein Messingrohr r eingebaut ist. Die Luft versetzt beim Durchströmen durch das Rohr das
Rädchen in Drehung, welche durch die, Kupplung u der
Antriebsachse a des Zählwerkes mitgetheilt wird. Durch
eine doppelte Räderübersetzung wird dann die Bewegung derart auf die Achse b (Fig. 3)
übertragen, daſs dieselbe eine Umdrehung bei 100 Drehungen von a macht; gleichzeitig wird von letzterer ein Windfang
w in Gang gesetzt. Die Theilbewegung der Achse b wird durch einen mit ihr verbundenen Zeiger z auf einem Zifferblatte angegeben. Jede ganze
Umdrehung desselben, beziehungsweise der Achse b, wird
durch ein Vorgelege v so auf einen zweiten lose auf b sitzenden Zeiger p
übertragen, daſs dieser hierbei den 60. Theil einer Umdrehung beschreibt. Der Zeiger
z berührt bei jeder Umdrehung eine Contactfeder c, welche mit einer isolirt auf dem Zählwerkgehäuse g sitzenden Drahtklemme i
leitend verbunden ist, und kann dadurch den Schluſs einer Batterie bewirken, deren
Pole mit dieser Klemme und der auf dem Gehäuse leitend befestigten Klemme k in Verbindung stehen. In diese Leitung wird an
beliebiger, als Beobachtungsort gewählter Stelle ein Controlapparat eingeschaltet,
welcher die Zeigerdrehungen registrirt.
Dieser Apparat (Fig. 5 bis
7 Taf. 13) besteht aus dem in einer hölzernen Büchse untergebrachten
Elektromagneten e, dessen Drahtwindungen zu den beiden
Klemmen m und n geführt
sind, in welche die Leitungsdrähte befestigt werden. Bei jedem Stromschluſs zieht
der Elektromagnet seinen Anker d an, wobei die auf
diesem sitzende Schaltklinke t das mit 60 Zähnen
versehene Schaltrad s um einen Zahn weiter schiebt, so
daſs der von der Achse dieses Rades getragene Zeiger x
genau die Bewegung des Zählwerkzeigers p nachmacht.
Soll der Zugmesser vom Beobachtungsort aus in Bewegung gesetzt und abgestellt werden
können, so muſs die in Fig. 8 und
9 veranschaulichte Einrichtung getroffen werden. Auf das Rohr r des Zugmessers wird ein Elektromagnet E aufgeschraubt, dessen Anker mit einem Stift A auf der Scheibe der Kupplung u aufsitzt und diese bremst, so lange er nicht angezogen ist. Zieht
dagegen der Elektromagnet den Anker an, so wird die Kuppelscheibe frei, und der
Bewegung des Flügelrädchens im Zugmesser steht kein Hinderniſs mehr entgegen. Der
früher beschriebene Controlapparat wird dann auf einem Bretchen B befestigt, welches an seinen Enden je 3 Drahtklemmen
M, N, O und R, S, T,
auſserdem zwei um die Zapfen C und D drehbare Messingschienen L trägt; letztere sind durch ein Hartgummistück mit einem
gemeinschaftlichen Knopf H verbunden, mittels welchen
sie über die mit halbrunden Köpfen versehene Contactstifte V, W geschoben werden können. Das eine Drahtende des Elektromagneten e im Controlapparat ist über M mit der Klemme k des Zugmessers, das andere
Drahtende über T mit dem Zinkpol einer der zum Betrieb
erforderlichen Batterien verbunden. Der Zinkpol der anderen Batterie steht mit der
Klemme R und diese wieder mit dem Drehbolzen C in Verbindung. Die Kupferpole beider Batterien sind
zur Klemme S und von da zum Drehbolzen D geleitet. Endlich steht noch der Contact W über N mit der Klemme
i des Zugmessers und der Contact V über 0 mit der Klemme X
des Elektromagneten E in Verbindung.
Sind nun die beiden Messingschienen L auf die Contacte
V, W geschoben, so geht der Strom der ersten
Batterie von S zu D, W, N,
i, dann durch das Gehäuse g und die Kupplung
u zum Elektromagneten E und weiter zu X, O, V, C, R. Der Anker des
Elektromagneten E wird dann angezogen und dadurch die
Drehung des Flügelrädchens im Zugmesserrohr zugelassen. Der Strom der zweiten
Batterie geht von S zu D, W, N,
i und bei jedesmaligem Contact des Zeigers z
durch diesen in die isolirte Klemme k, dann zu M und durch den Elektromagneten e des Controlapparates zu T. Werden die
beiden Schienen L von den Contactstiften V, W weggeschoben, so ist die Leitung unterbrochen und
der Apparat abgestellt.
F. H.
Tafeln