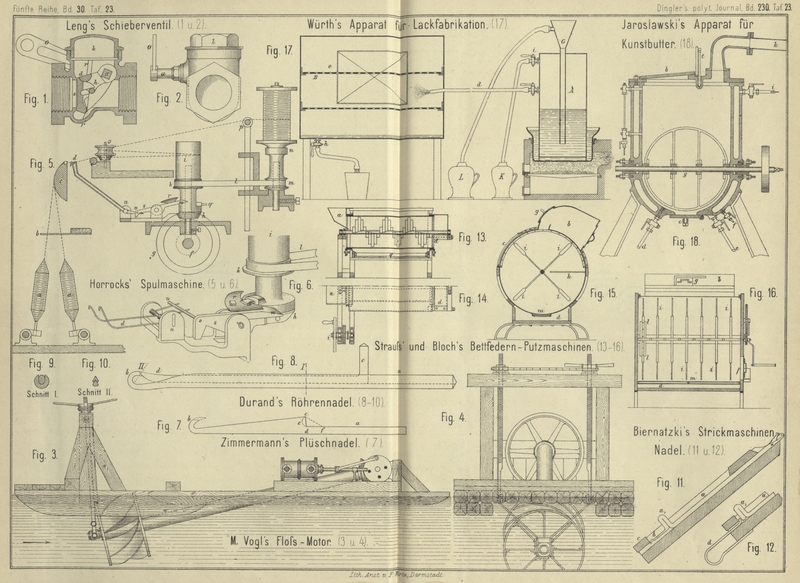| Titel: | Neue Constructionen von Wirkmaschinen-Nadeln. |
| Autor: | G. W. |
| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 223 |
| Download: | XML |
Neue Constructionen von
Wirkmaschinen-Nadeln.
Mit Abbildungen auf Tafel 23.
Neue Constructionen von Wirkmaschinen-Nadeln.
Mit dem Namen „Nadeln“ werden in der Wirkerei mancherlei Drahtstäbchen von
verschiedenen Formen, Gröſsen und Verwendungsweisen bezeichnet. Hauptsächlich führen
diejenigen in den Wirkmaschinen vorkommenden Drahthaken diesen Namen, an welchen die
Maschen des gewirkten Stoffes hängen und die zur Herstellung dieser Maschen, ähnlich
wie die Stricknadeln der Handarbeit, dienen. In neuerer Zeit hat man in einzelnen
Ausführungsformen derselben folgende weitere Verbesserungen angebracht, theils zum
Zwecke weiter gehender Verwendung, theils in der Absicht, die Nadeln leichter
handlich und arbeitsfähig zu machen.
Eine neue Plüsch-Nadel von Chr. Zimmermann und Sohn in Apolda (*D. R. P. Nr. 2091
vom 25. November 1877) ist dazu bestimmt, die Plüschhenkel der Kettenwaare während
des Wirkens der letzteren zugleich aufzuschneiden. Sie ist am Fangkettenstuhle,
welcher jetzt vielfach zur Herstellung von Kettenplüsch benutzt wird, zu verwenden.
Im Falle solcher Plüscharbeit enthält dieser Fangkettenstuhl nur in einer
Nadelreihe, der Stuhlreihe, die gewöhnlichen Haken- oder auch Zungennadeln zur
Maschenbildung des Grundgewirkes, und die andere Reihe ist nur aus Stiften gebildet,
welche dazu bestimmt sind, bei jeder Legung eine Schleifenreihe der Fäden mit zu
erhalten, welche später die Plüschhenkel bilden, aus denen sich aber die Stifte nach
Beendigung der Reihe leicht herausziehen können. Als Ersatz dieser Stifte sind die
neuen Plüschnadeln zu betrachten. Dieselben enthalten, wie Fig. 7 Taf.
23 zeigt, auf ein Stück ihrer Länge einen breiten Schaft und vorn einen kürzeren
oder längeren Haken b. Da, wo der Schaft plötzlich schmäler abgesetzt ist,
hat man die Kante cd wie ein Messer zugeschärft und sie
entweder senkrecht auf a stehend, wie cd, oder bogenförmig wie ced, oder schräg wie cf geformt. Wenn nun
eine Reihe gewirkt ist, so halten die Haken b die
Plüschhenkel; wird dann die ganze Nadelreihe a in der
Längsrichtung der Nadeln verschoben, so gleiten die Henkel hinter oder unter cd hin (die Nadeln a
stehen im Stuhle vertical), und wenn man dann die Reihe a wieder senkt, so durchschneidet jede Kante cd ihren Plüschhenkel. Auf diese Weise befreien sich die Nadeln a selbst von ihren Henkeln und brauchen nicht aus ihnen
herausgezogen zu werden,
Die Abänderung der Röhrennadel von
Eug. Durand in Paris (*D. R. P. Nr. 2100 vom 8.
Januar 1878) greift wieder zurück zu einer alten Erfindung (vgl. Sächsisches Patent
von Lembcke und Gottlebe in Wittgensdorf bei Chemnitz
vom J. 1858), nach welcher die Stuhlnadeln nicht mehr den langen Haken enthalten,
dessen Spitze bisweilen, behufs der Maschenbildung, herab in eine Nuth des
Nadelschaftes gedrückt wird, sondern deren Nadelschaft selbst aus einem
Blechröhrchen besteht, in welchem ein Drahtstift sich lang hin- und herschieben
läſst. An einem Ende ist die Röhre einseitig zu einem Haken ausgefeilt und, wenn der
Draht nach vorn geschoben wird, so legt er sich auf das Hakenende und schlieſst den
Hakenraum. Diese Verschiebung des Drahtes ersetzt also die Arbeit des Pressens der
gewöhnlichen Hakennadel, ist aber nicht eine so schwere Arbeit als wie die letztere.
Zu demselben Zwecke, um also dem Arbeiter das „Pressen“ zu ersparen, ist auch
die Zungennadel erfunden worden und hat den beabsichtigten Nutzen so leicht und in
so hohem Maſse ergeben, daſs sie jetzt überaus vielfach verbreitet ist.
Wenn nun die jetzt von Durand angegebene Veränderung der
Röhrennadel die letztere wiederum zum Ersätze der Zungennadel befähigen soll, so
erscheint eine solche Absicht wohl schwer erreichbar; – jedenfalls ist das Resultat
der Bestrebungen abzuwarten. Nach der neuen Construction besteht der Nadelschaft
nicht mehr aus einer Röhre, sondern ist ein maſsiver runder oder etwas flach
gepreſster Drahtstab a (Fig. 8 bis
10 Taf. 23), in welchem man eine Nuth eingehobelt oder eingefräst hat,
und in dieser Nuth verschiebt sich der Drahtstab cd. An
a ist auf der einen Seite der kurze Haken b angebogen und cd enthält
auf der entgegengesetzten Seite ein rechtwinklig aufwärts gebogenes Ende c. Sämmtliche Stäbchen cd
werden von einer Schiene bei c erfaſst und hin und her
geschoben zum Oeffnen oder Schlieſsen des Hakenraumes b. Man kann auch umgekehrt die Stäbchen cd
festhalten und die Nadeln ab bewegen lassen; jedenfalls
geschieht aber das Oeffnen und Schlieſsen des Hakenraumes nicht mehr, wie bei den
Zungennadeln, durch die Waare selbst, sondern ist von der Maschine besonders zu
verrichten.
Die Neuerung an der Zungen-Nadel von J.
Biernatzki in Hamburg (*D. R. P. Nr. 2104 vom 19. Januar 1878) besteht, wie
Fig. 11 Taf. 23 zeigt, darin, daſs die Nadel a am unteren Ende, unterhalb des Schloſshakens a1, zugleich die Feder b enthält, welche man sonst gewöhnlich getrennt in die
Nadelbetten einlegen muſste, wie d in Fig. 12
(vgl. *1869 191 9). Während durch Hinaufschieben von d die Nadel a in ihre
Arbeitslage gebracht wird, in welcher der Haken a1 von dem Schlosse der Maschine getroffen werden
kann, ist nach der neueren Einrichtung ein Hinaufschieben der Nadel a erforderlich, so weit, bis b nahe an der unteren Querschiene c anstöſst.
Die alten Federn d werden mit der Zeit locker, rutschen
zurück und halten die Nadeln a nicht sicher in der
richtigen Lage; dies geschieht aber durch die neuere Einrichtung mit gröſserer
Zuverlässigkeit. Soll die Nadel nicht mit arbeiten, so wird sie so weit
hinabgeschoben, daſs die Feder b unter der Schiene c liegt.
Die Unsicherheit in der Wirkung der alten Federn d hat
schon zu einer der obigen ähnlichen Verbesserung Veranlassung gegeben (vgl.
Sächsisches Patent von Bach und Groſser in Markersdorf
bei Burgstädt in Sachsen vom J. 1876), nach welcher auch jede Nadel ihre eigene
Feder trägt, aber in anderer als der obigen Ausführungsform.
G. W.
Tafeln