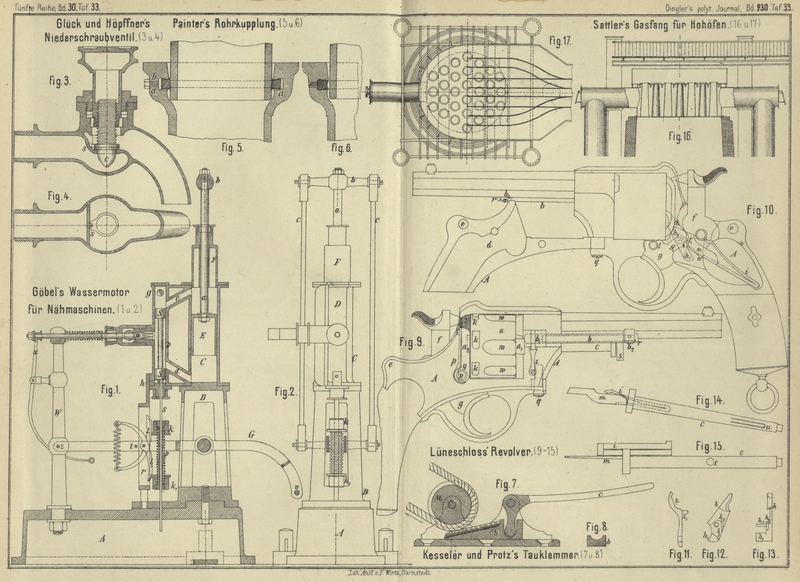| Titel: | Revolver „Warnant“ von P. D. Lüneschloss in Solingen. |
| Autor: | F. Hentsch |
| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 404 |
| Download: | XML |
Revolver „Warnant“ von P. D. Lüneschloſs
in Solingen.
Mit Abbildungen auf Tafel 33.
Hentsch. über Lüneschloſs' Revolver.
Dem Waffenfabrikanten P. D. Lüneschloſs in Solingen ist
das Deutsche Reichspatent Nr. 384 vom 27. Juli 1877 ab auf ein neues originelles
Revolversystem, „Warnant“ genannt, ertheilt worden, welches in vielen
Beziehungen von den anderen Waffen dieser Gattung abweicht. Fig. 9 Taf.
33 zeigt die Ansicht des Revolvers von der rechten Seite im abgeschossenen Zustande,
Fig. 10 Ansicht von links bei geöffnetem Schloſskasten, Fig. 11 bis
13 Ansichten der einzelnen Schloſstheile, Fig. 14 und
15 Ansichten der Schlagfeder mit aufgeschobener Walzenachse.
Was die Construction des Revolvers betrifft, so besteht das kastenartige Gestell A aus einem Stücke; die linke Wand d, welche bei geschlossenem Kasten durch einen Bolzen
bei e gehalten wird, kann um eine senkrechte Schraube q nach vorn aufgedreht werden, wodurch der ganze
Schloſsmechanismus frei gelegt ist. Der Lauf steht etwas über die hintere Fläche der
vorderen Kastenwand hervor. Senkrecht darunter liegt die Walzenachse c, welcher in der Vorderwand eine cylindrische Bohrung
und in dem Stoſsboden eine gleiche Auſsenkung entspricht; in erstere greift der
Ansatz z1 einer Feder
z (Fig. 11),
durch welchen die Walzenachse auf ihrem Platze gehalten wird. Um die Bohrung ist an
der hinteren Seite der Vorderwand eine Auſsenkung zur Aufnahme eines Zapfens a1 der Walze a angebracht; von dieser Auſsenkung führt ein Gang
gleicher Breite nach der rechten Seite heraus. Um die in dem Stoſsboden befindliche
Vertiefung ist eine gleiche Auſsenkung angebracht, in welche das Zahnwerk der Walze
a tritt. Von ihr führt ebenfalls ein Gang a2 nach der rechten
Seite heraus. Durch die Anbringung dieser beiden Gänge in den Gestellwänden ist es
möglich gemacht, die Walze a nach Entfernung der Achse
c aus dem Gestelle A
nach rechts herauszunehmen. An der rechten Seite der vorderen Gestellwand ist ein
cylindrisch durchbohrter Ansatz b1 und in der Verlängerung dieses an der rechten
Seite des Laufes ein ebensolcher b2 angebracht; beide Ansätze dienen zur Aufnahme des
Entladestockes b, ein hinten geschlossenes Rohr, in
welches eine Spindel r eingeschoben ist, die durch eine
kleine Schraube in dem Laufansatze b2 gehalten ist. Der Entladestock b besitzt an seinem vorderen Ende einen Griff s, welcher sich vor die Walzenachse c legt und letztere ebenfalls auf ihrem Platze erhält,
ist auf der Seite des Griffes s abgeplattet und an
seinem hinteren Ende mit einer Auslassung versehen; gegen die Abplattung und in
diese Auslassung drückt die in einem Einschnitte des Kastenansatzes liegende und
durch eine Schraube befestigte Feder z. Dieselbe hält
den Entladestock b in den verschiedenen Stellungen
fest. Beim Beginn des Drehens des Entladestockes b wird
sie abgebogen und gespannt, legt sich bei weiterem Drehen gegen die Abplattung
bezieh. in den Einschnitt, und zwar gegen erstere beim Entladen der Walze a, also Zurückschieben des Entladestockes b, in den letzteren bei fertig gemachtem Revolver;
hierbei hält die Feder den Entladestock und verhindert eine Rückbewegung
desselben.
Die Walzenachse c besitzt an ihrem vorderen Ende einen
Kopf, dessen dem Laufe zugekehrte Seite abgeplattet ist und an der unteren Seite des
Laufes anliegt, um ein Drehen der Achse zu verhindern. An der entgegengesetzten
Seite ist ein schwalbenschwanzartiger Einschnitt angebracht, welcher zum Aufschieben
des Kopfes auf die Schlagfeder i bei dem
Auseinandernehmen des Schlosses dient. Etwas in der Mitte von c befindet sich eine Vertiefung t (Fig. 15)
zur Aufnahme des Federansatzes z1. Um die Reibung in der Walze a etwas zu vergröſsern, ist in dem hinteren, in der
Walze liegenden Theil der Achse eine kleine nach auſsen wirkende Feder u (Fig. 14)
angebracht.
Die Walze a entspricht derjenigen anderer Revolver; zur
Erleichterung und zum besseren Erfassen derselben ist zwischen je zwei der sechs
Kammern auf der Auſsenfläche eine muldenförmige Vertiefung w angebracht. Die Patronen werden von hinten eingebracht und die leeren
Hülsen nach und nach hier entfernt. Um dies zu ermöglichen, ist die rechte Seite des
Stoſsbodens beseitigt und daselbst eine nach rückwärts um den Bolzen o umlegbare Klappe y
angebracht, welche in aufrechter Stellung die Kammern hinten schlieſst; eine Feder
p hält die Klappe in der aufgerichteten, bezieh.
niedergelegten Stellung.
Das Schloſs ist auſserordentlich einfach und besteht nur aus dem Hahne f, der Schlagfeder i, dem
Heber h und dem Abzüge g.
Der Hahn ist im Allgemeinen wie bei allen anderen Revolvern mit Centralzündung
geformt; er weicht nur insofern ab, als seine Spannrast an einem nach vorn
gerichteten Ansätze f angebracht ist, unter welchen ein
Ansatz h1 des Hebers
h tritt. Der Hahn f
und der Abzug g sind auf cylindrische Ansätze der
rechten Seitenwand des Schloſskastens geschoben. Dieselben treten bei geschlossenem
Gestelle mit ihren abgerundeten Enden in entsprechende Löcher der linken Wand d. Unter einen Ansatz der hinteren Seite des Hahnes
tritt der obere Arm der Schlagfeder i; deren unterer
Arm legt sich bei abgeschossenem Gewehre auf eine nach hinten gerichtete Nase n des Hahnes und ist mit einem an der Seite
angebrachten, nach vorn gerichteten und zwischen Hahn und Heber liegenden Ansätze
m versehen, welcher auf einen Absatz h2 des Hebers h wirkt und diesen stets nach vorn in das Zahnwerk
drückt. Dieser Federarm übernimmt zugleich die Functionen der Abzugsfeder, da der
Heber mit dem Abzüge fest verbunden ist. Der Heber tritt mit einem seitlich
angebrachten Zapfen h3
(Fig. 13) in eine Bohrung des nach hinten gerichteten Abzugsansatzes g1. An seiner nach
innen zugekehrten Seite ist eine Auslassung, in welche der Schlagfederansatz m tritt und auf den Absatz h2 sich legt. Endlich ist der Abzug g an dem Ansätze g1 mit einem Zahn zum Eintreten in die Hahnrast f1, und oben unter der
Walze a mit einer Nase l
versehen, welche in die Auslassung k der Walze tritt
und dadurch bei dem Schusse deren Drehung verhindert.
Was nun das Zusammenwirken der Schloſstheile betrifft, so dreht man behufs Ladens die
Klappe y nach hinten, führt die sechs Patronen nach und
nach in die Kammern und stellt hierauf die Klappe y
wieder hoch. Bei der Entzündung kann entweder jedes Mal der Hahn f mit der Hand gespannt, oder dies auch durch weiteres
Zurückziehen des Abzuges g bewirkt werden. In letzterem
Falle wird bei dem Zurückziehen des Abzuges dessen Ansatz g1 und damit der Heber h gehoben, dieser durch den unteren Schlagfederarm vor
und in das Zahnwerk der Walze a gedrückt und dadurch
deren Drehung veranlaſst. Der untere Ansatz h1 des Hebers trifft bei dem Hochgehen die Hahnrast
f1, hebt den Hahn, dreht ihn nach
rückwärts und spannt dadurch die Schlagfeder i. Ist die
Walze a so weit gedreht, daſs eine Patrone vor der
Hahnspitze liegt, so springt der Ansatz g1 in die Rast f1 und hält den Hahn in dieser Stellung fest.
Zugleich tritt auch die Nase l in die betreffende
Walzenauslassung k und verhindert ein Drehen der Walze
a. Wird der Abzug g
nun nur noch um ein geringes weiter zurückgezogen, so gleitet sein Ansatz g1 an der Rast f1 vorbei, der Hahn f wird nicht mehr festgehalten, der obere Arm der
Schlagfeder i gelangt in Thätigkeit, schnellt den Hahn
f vor und die Entzündung erfolgt. Die Hahnrast f1 geht dabei nieder
und tritt unter den Heberansatz h1 , während der Hahnansatz n den unteren schwächeren Arm der Schlagfeder i hebt und anspannt. Läſst man nunmehr den Abzug g frei, so gleitet der Heberansatz h1 an f1 vorbei, weicht dabei nach vorn aus, wodurch sein
oberes Ende zurückgeht und nun unter den folgenden Zahn des Zahnwerkes gebracht
wird. Der Hahnansatz f1
tritt wieder über den Heberansatz h1, der untere Schlagfederarm geht nieder, da der
Hahn f durch den Heber h
bei dessen Niedergang nicht festgehalten wird, und veranlaſst dadurch den Hahn f zu einer geringen Drehung nach hinten und zum
Zurücktreten seiner Schlagspitze. Letzterer nimmt also eine Art Ruhestellung ein,
welche durchaus sicher ist und jede Selbstentzündung unmöglich macht, da die
Hahnrast f1 sich auf
den Ansatz h1 des
Hebers legt, dieser aber durch den festliegenden Abzug g verhindert wird, nach unten auszuweichen, wodurch also auch die
Hahnschlagspitze verhindert wird, vorzugehen.
Behufs Entladens wird die Klappe y geöffnet, der
Entladestock b so gedreht, daſs sein Griff s vom Lauf absteht, die Feder z auf der Abplattung liegt und hierauf b
zurückgeschoben werden kann. Das Auseinandernehmen und Zusammensetzen der Waffe
ergibt sich nach der gegebenen ausführlichen Beschreibung von selbst. Was den Werth
der Waffe betrifft, so zeichnet sie sich vor allen anderen Revolvern durch ihre
auſserordentlich groſse Einfachheit, die geringe Zahl ihrer Schloſstheile und
dadurch aus, daſs im ganzen Schloſsmechanismus nur eine Feder vorhanden ist. Eine
glückliche Idee ist ferner die thürartige Befestigung der linken Gestellwand, da
hierdurch auf leichte Weise der Schloſsmechanismus frei gelegt, gereinigt und jede
Störung schnell beseitigt werden kann, auch das Abnehmen der Holzschalen bei jeder
Reinigung, wie es die anderen Revolverconstructionen zum gröſsten Theile bedingen,
unnöthig gemacht ist. Ein fernerer Vorzug besteht darin, daſs die Waffe stets in
durchaus sicherer Ruhestellung sich befindet und die Walze ohne Lösung irgend einer
Schraube aus dem Gestelle genommen werden kann. Endlich ist die Befestigung der
Walzenachse auch ohne Schraube durch die eigentümliche Einrichtung des
Entladestockes und seiner Feder z eine durchaus
sichere.
F. Hentsch.
Tafeln