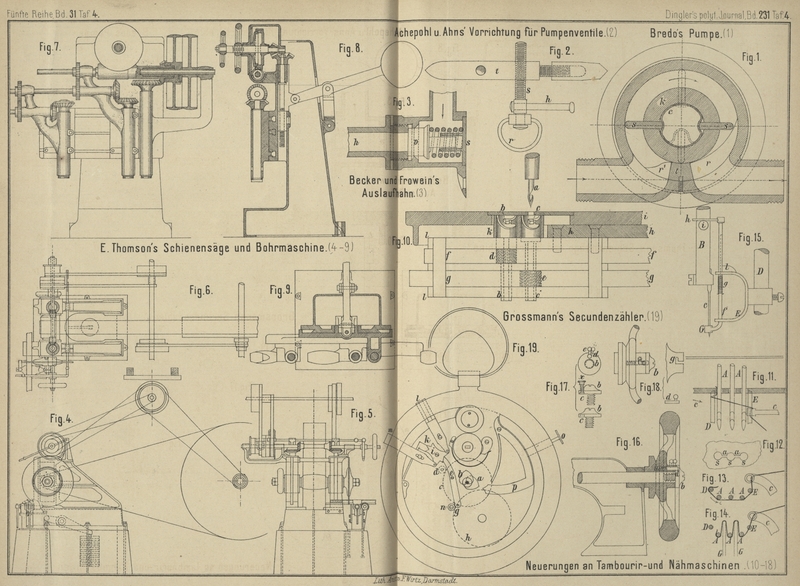| Titel: | K. M. Grossmann's Secundenzähler. |
| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 34 |
| Download: | XML |
K. M. Groſsmann's Secundenzähler.
Mit einer Abbildung auf Tafel 4.
Groſsmann's Secundenzähler.
Die zu Zeitbeobachtungen angewendeten Chronographen sind Uhren mit einem groſsen, in
⅕ Secunden sich bewegenden Zeiger, welcher nach Belieben abgestellt werden kann,
indem man die Bewegungsübertragung vom Secundenrad unterbricht; der Zeiger wird
dabei vor Beginn jeder neuen Beobachtung auf Null zurückgestellt. Die verschiedenen
Functionen werden durch einen einzigen Drücker unter Vermittlung eines 12- oder
18theiligen Sternes erzeugt; doch ist der Mechanismus ziemlich complicirt, namentlich dann, wenn
auſser dem Secundenzeiger noch ein ebenso wirkender Minutenzeiger verlangt wird. K M. Groſsmann in Glashütte in Sachsen (*D. R. P. Nr. 1751 vom 12. Januar 1878) war deshalb bemüht,
denselben Zweck mit einfacheren Mitteln zu erreichen.
Sein Secundenzähler ist ein vereinfachtes Uhrwerk, da dasselbe nur 2 Stunden lang
nach erfolgtem Aufziehen geht. Mit dieser Uhr ist der in Fig. 19
Taf. 4 abgebildete Auslösungsmechanismus verbunden. Auf der mittleren Achse, welche
eine minutliche Drehung macht, ist unter dem Zifferblatt eine Herzscheibe a und über demselben der Secundenzeiger befestigt,
während der Minutenzeiger auf einer über diese Achse geschobenen Hülse sitzt, die
auſserdem eine Herzscheibe b und das Rad c trägt; letzteres wird vom Uhrwerk aus durch den Trieb
d mit entsprechender Geschwindigkeit getrieben. In
der Regel wird die Unruhe h der Uhr durch einen am
Hebel e befestigten Stift g festgehalten. Drückt man jedoch auf den durch das Gehäuse tretenden
Stift m, so erhält der Hebel e durch das Stück i eine solche Schwingung,
daſs sich sein federndes Ende bei g auf die
abgeschrägte Scheibe n schiebt und dadurch so viel
aufgebogen wird, daſs der Stift g aus der Unruhe tritt
und diese frei macht, worauf die Uhr sofort in Gang kommt. Das Wippstück i wird durch die Feder k
in seiner Lage erhalten.
Beim Niederdrücken des Stiftes m tritt der gleichfalls
mit i verbundene Stift l
aus dem Gehäuse; drückt man nun letzteren zurück, so gelangt der Hebel e in seine frühere Lage, der Stift g greift wieder in die Unruhe und die Uhr ist
abgestellt. Wird dann noch mittels des Drückers o der
federnde Hebel p gegen die Herzscheiben a und b gedrückt, so
stellen sich die Zeiger dadurch auf Null ein.
Tafeln