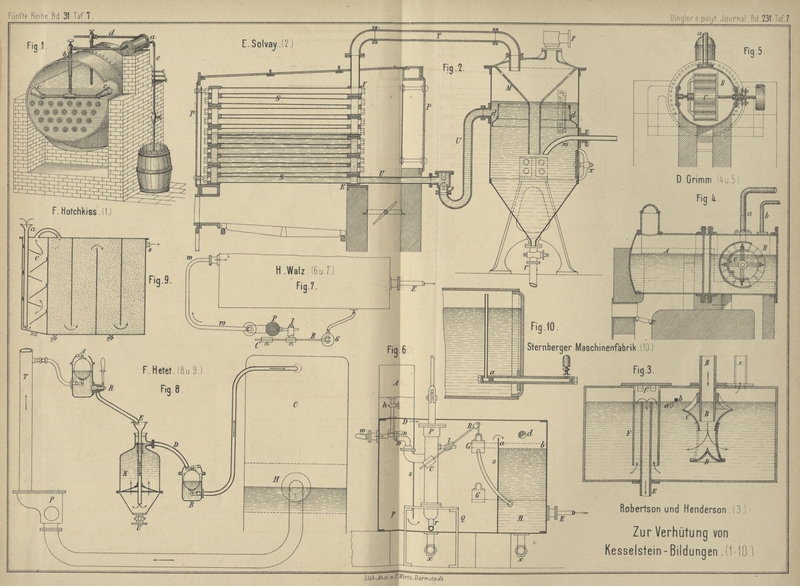| Titel: | Zur Verhütung von Kesselsteinbildungen. |
| Autor: | F. |
| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 58 |
| Download: | XML |
Zur Verhütung von
Kesselsteinbildungen.
Mit Abbildungen auf Tafel 7.
Zur Verhütung von Kesselsteinbildungen.
Im Anschluſs an die früheren Mittheilungen über Verhütung von Kesselsteinbildungen
mögen hier die neuesten diesbezüglichen Vorschläge besprochen werden. Zur leichteren
Uebersicht soll die frühere Eintheilung (*1876 220 173)
beibehalten werden.
Elektricität und Zinkeinlagen. Ueber die Anwendung des
Zinkes (*1876 222 166) liegen mehrere Mittheilungen
vor.Annales des Mines, 1877 Bd. 12 S. 155. Engineering, 1878 Bd. 26 S. 29. Man
vermuthet noch immer elektrische Ströme, ohne bisher irgendwo solche nachgewiesen zu
haben; im günstigsten Falle können sie nur kurze Zeit andauern (vgl. 1876 222 247). Versuche auf der Zinkerzgrube Cäciliie bei Beuthen mit Zinkeinlagen in Unterkesseln
lieſsen keinerlei Wirkung derselben auf die Kesselsteinbildung erkennen.Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen,
1877 S. 245. Eine solche wird auch nur in seltenen Fällen
eintreten können. – Aehnlich spricht sich auch L. BourL. Bour: Note sur l'emploi du zinc pour empêcher
les incrustations dans les chaudières à vapeur (Lyon
1878). aus.
Schlammfänger. F. HotchkissNeueste Erfindungen, 1878 S.
257. will die in Fig. 1 Taf.
7 gezeigte Vorrichtung verwenden. Sobald der Kessel geheizt wird, soll das
Kesselwasser lebhaft in die Trichterrohre c einströmen,
in b aufsteigen, durch den kleinen Behälter a hindurchflieſsen und schlieſslich durch das Rohr d wieder in den kälteren Theil des Kessels zurückgehen.
Der in a abgesetzte Schlamm wird durch das Rohr e entfernt. Es wird behauptet, der Apparat sei auf
durchaus wissenschaftlichen Principien basirt und diene dazu, die Niederschläge in
jenem Stadium ihrer Bildung und Freiwerdung, wenn sie auf der Wasserfläche
schwimmen, sofort aus dem Dampfkessel fortzuschaffen, und zwar nach auſsen hin,
wodurch selbstverständlich die Bildung von Kesselstein und das Festsetzen der
Niederschläge am Boden ganz wegfalle. – Diese Angabe ist natürlich nicht zutreffend;
im günstigsten Falle wird die Schlammansammlung vermindert.
E. Solvay in Brüssel (*D. R. P. Nr. 175 vom 26. Juli
1877) hat den in Fig. 2 Taf.
7 dargestellten Apparat construirt, welcher namentlich für Siederohrkessel bestimmt
ist. Die über einander liegenden Siederohre S bilden
ein Schlangenrohr; mehrere der letzteren sind am unteren Ende durch ein Querrohr E und oben durch ein zweites Querrohr V verbunden. Dadurch soll erreicht werden, daſs der
entwickelte Dampf möglichst viel Wasser mitreiſst und durch das Rohr T in den Absatzbehälter M
führt. Hier trennen sich Dampf und Wasser; der trockene Dampf entweicht durch die
Leitung F, das Wasser setzt seine Uneinigkeiten am
Boden des Gefäſses ab, flieſst über den Rand der ringförmigen Rinne d und gelangt durch das Rohr U mit dem Ventil s nach dem Kessel zurück.
Das Rohr w führt neues Speisewasser zu, durch das Rohr
r oder das Mannloch x
wird der angesammelte Schlamm entfernt. P sind
Reinigungsthüren des Kessels.
Auch diese Vorrichtung kann trotz der Versicherung des Erfinders die
Kesselsteinbildung nicht verhindern; noch weniger kann sich ein bereits incrustirter
Kessel dadurch allein wieder reinigen. Sie dürfte kaum nennenswerthe Vorzüge den bis
jetzt bekannten ähnlichen Apparaten (vgl. 1876 220 174)
gegenüber haben.
Talk. Der Vorschlag Marie'sPolytechnic Review, 1878 Bd. 5 S.
274., Talk gegen Kesselsteinbildung anzuwenden, ist weder
neu, noch empfehlenswerth (vgl. 1876 220 177).
Fetten der Kesselwände. Nach F. BüttgenbachIndustrieblätter, 1878 S.
414. mischt man 25 Th. Colophonium, 2,5 Th. Graphit und 2,5 Th.
Schwärze mit 240 Th. Gastheer, erwärmt unter Umrühren und fügt 6 Th. Talg und 140
Th. Erdöl hinzu. Mit der noch warmen Lösung werden die Kessel angestrichen. Der
Anstrich soll unberechenbare Vortheile bringen! – J.
Bernard in Paris (D. R. P. Nr. 2025 vom 11. September 1877) mischt 1k Seife, 1k
Kartoffeln oder Stärkemehl und 1k Ochsengalle;
statt des Stärkemehles kann auch jedes andere Mehl, Leim u. dgl. verwendet werden.
Dieses Gemisch, in die Kessel gebracht, soll alte Krusten ablösen, die innere
Oberfläche des Kessels vollkommen rein und sauber halten, zugleich soll aber auch
der aus einem solchen Kessel entwickelte Dampf Schieber, Hähne, Cylinder, Kolben
u.s.w. schmieren. Daſselbe müſste demnach theilweise durch den Dampf mit
übergerissen werden, was bei derartigen schmierenden Mitteln allerdings wohl
vorkommt (vgl. 1878 230 135), – Grund genug, dieselben
nicht anzuwenden.
Gerbstoffe u. dgl. Cooper und SmithMoniteur industriel, 1878 Bd. 5 S.
507. empfehlen Natriumtannat gegen Kesselsteinbildungen,
welches sie krystallisirt und flüssig liefern; dasselbe hat folgende
Zusammensetzung:
Krystallisirt
Flüssig
Krystallisirte Soda
95,5
25,1
Tannin
1,2
1,4
Wasser
3,0
72,6
Organische Stoffe
0,3
0,9
––––––––––––––––––––––
100,0
100,0.
Das kohlensaure Natrium soll die Kalksalze fällen, das Tannin
aber dem Niederschlage eine schlammige Beschaffenheit geben, weiche das Anhaften
desselben an die Kesselwandungen verhüten soll. Weit besser würde es offenbar sein,
nur mit Soda zu fällen, den Niederschlag aber gar nicht in den Kessel
hineinzubringen.
Meldrum und Cail
(Englisches Patent Nr. 1969 vom 19. Mai 1877) wollen Lederabfälle auf 400° erhitzen
und dann mit Kalk oder Natron kochen, oder aber gerbstoffhaltige Pflanzenstoffe mit
Wasser auskochen und diese Lösungen in die Kessel bringen.
J. Rolf und G. O. Kramer in
Osnabrück haben, wie sie in einer Flugschrift behaupten, durch Zufall ein ebenso
interessantes, als einfaches, fast kostenloses Verfahren entdeckt, um den
Kesselstein in den Dampfkesseln zu isoliren. Der Erfolg ist so überraschend, daſs
dieses Verfahren selbstverständlich in kurzer Zeit alle anderen Mittel verdrängt
haben wird! Wer das Mittel anwenden will, hat sich durch Unterschrift zur
Geheimhaltung des Verfahrens zu verpflichten und für 1 Kessel 100 M., für 2 Kessel
180 M. u.s.f. zu bezahlen. – Das ganze wunderbare Verfahren besteht nun lediglich
darin, daſs man in jeden Kessel einige Reiserbündel, namentlich von Eichen, bringen
soll. Wunderbar ist hierbei nur, daſs es noch immer Leute gibt, welche für eine
schon seit dem J. 1839 bekannte Geschichte (vgl. 1876 220
179) solche Geldsummen ausgeben, noch wunderbarer, daſs der Bauinspector Reiſsner in Osnabrück u.a. öffentlich bescheinigen
mögen, daſs sich das Mittel aufs glänzendste bewährt.
Daſs es wenigstens für Kessel mit Unterfeuer auch sehr gefährlich werden kann, liegt
auf der Hand. Ein hier in Hannover ausgeführter Versuch bei einem Flammrohrkessel
ergab, daſs der Kesselstein nicht vermindert wurde, daſs der Kessel aber grenzenlos
verschmiert war.
Blondonneau empfiehlt Ulminsäure und ulminsaure Salze;
ulminsaures Alkali soll Kalkulmat bilden, welches keine festen Krusten gibt. – Die
Anwendung von Torf gegen Kesselsteinkrusten ist nicht neu (vgl. 1876 220 177), auch nicht besonders empfehlenswerth.
Stärkemehlhaltige Stoffe. HoppeVerhandlungen des Vereines zur Beförderung des
Gewerbfleiſses 1878 S. 171. empfiehlt einmal wieder
Kartoffeln, A. RautertGewerbeblatt für Hessen, 1878 S.
220 Carraghenmoos, alte Vorschläge, vor deren Anwendung nur
gewarnt werden kann (vgl. 1876 220 180).
Vorwärmer. J. Lovegrove und T.
Baker haben Vorwärmer construirt, in denen der Abdampf nicht mit dem Wasser
in Berührung kommtPolytechnic Review, 1878* Bd. 5 S. 231 und
283.; letzterer verbindet diesen Vorwärmer mit einem Filter. –
Robertson und HendersonIron. 1878* Bd. 11 S. 616
lassen dagegen den Abdampf durch das Rohr B (Fig.
3 Taf. 7) in das Wasser selbst eintreten; in Folge der eigenthümlichen
Mündung CD dieses Rohres sollen im Wasser Strömungen
entstehen, damit dasselbe gleichmäſsig vorgewärmt wird. Der nicht condensirte Dampf
entweicht aus dem Rohr x. Das so vorgewärmte Wasser
steigt in dem Rohre F auf und flieſst durch das zur
Speisepumpe führende Rohr E ab. Die auf diese Weise
zurückgehaltenen Fett-
und Schmutztheile werden durch die Oeffnung a
abgelassen, während das vorzuwärmende Wasser durch b
eintritt. Die Oeffnungen f endlich sind angebracht,
damit im Rohre F derselbe Druck herrscht als im ganzen
Vorwärmer.
D. Grimm in Nürnberg (*D. R. P. Nr. 2213 vom 8. November
1877) will mit dem auf die Hälfte der bisherigen Länge verkürzten Dampfkessel A (Fig. 4 und
5 Taf. 7) den Vorwärmer B verbinden, in
welchem sich ein mittels Riemenscheibe in Umdrehung gesetztes Schaufelrad C befindet. Hierdurch soll der aus a eintretende Abdampf der Maschine mit dem Wasser
vollkommen gemischt und somit die Wärme desselben besser ausgenutzt werden, als dies
mit anderen Vorrichtungen geschieht. Der nicht condensirte Dampf entweicht durch b. Besonders empfehlenswerth ist diese Vorrichtung
nicht.
Reinigung des Wassers mit Chemikalien. C. Schönemann in
Berlin (*D. R. P. Nr. 3238 vom 6. Juni 1878) hat einen Reinigungsapparat construirt,
welcher folgendermaſsen beschrieben wird.
Der Apparat besteht aus einem Kasten aus Eisenblech mit im Inneren
durch den Kasten gezogenen Querwänden, welche theils in der Wasserlinie endigen,
theils vom Boden abstehen. Nahe am Boden sind in einer Seitenwand zur Entfernung des
abgesetzten Schlammes oder Niederschlages aus dem zu reinigenden Wasser Rohre mit
Hahnverschluſs angebracht. Auf der einen Seite besitzt der Kasten einen Aufsatz von
Eisenblech; derselbe enthält einen Eisenblechteller mit Wasserüberfall, ein kleines
Wasserrad und eine besondere Rührvorrichtung, um das Wasser mit den. Zuthaten
tüchtig vor der Fällung zu mischen. Das zu reinigende Wasser flieſst aus dem über
dem Blechkasten befindlichen Behälter durch Rohr und Regulirhahn in den Aufsatz. In
dem Zufluſsrohr ist die Vorkehrung getroffen, daſs auf ganz selbstthätige Art und
Weise die Zuthaten (Chlorbarium, Kalkwasser u. dgl.) in bestimmten Mengen
fortlaufend und nur dann zugeführt werden, wenn das zu reinigende Speisewasser
überhaupt durch den Regulirhahn in den Apparat einströmt. Zu diesem Zweck sind
Rohrstücke in Schöpflöffelform endigend angebracht, welche die Flüssigkeiten aus
offenen, am Blechcylinder befestigten Bodenstücken entnehmen. In diese Blechcylinder
werden die Flüssigkeiten täglich einmal eingebracht. Die Rohrstücke sind in Lager
gelegt und tragen auf ihrer Verlängerung Holzscheiben, welche einerseits mit den
Scheiben auf der Wasserradachse correspondiren, während andererseits von diesem aus
auf die Wasser-Rührwelle entsprechende Scheiben aufgesetzt sind. Das einfallende
Wasser wird auf dem Eisenteller gleichzeitig mit den Flüssigkeiten gut zerstreut.
Die Rührvorrichtung gibt kräftige Mischung, und durch eingeleiteten Dampf in
bestimmter Höhe und Richtung von Dampfmaschinen oder direct aus Dampfkesseln erfolgt
bei höherer Wärme die chemische Zersetzung leichter und in kürzerer Zeit.
Ist der Wasserhahn auf einen bestimmten Zufluſs gestellt, sind
ebenso die Chemikalien dazu in richtiger und zu dem Wasser passender Menge und
Stärke abgemessen und die Blechcylinder gefüllt, so ist die Wasserreinigung ganz
selbstthätig und fortlaufend ohne besondere Aufsicht im Gange. Inzwischen setzt sich
in dem Blechkasten der gebildete Schlamm zu Boden, während das Wasser, in ruhigen
Zustand gekommen, fort- und durch ein am Ende des Kastens angebrachtes Rohr nach
einem Sammelbehälter abflieſst. Durch einen am Kasten angebrachten Hahn kann das
gereinigte Wasser auch periodenweise nach etwa 1 Stunde Stillstandszeit völlig
geklärt abgelassen werden. Durch ein eingehängtes offenes Rohr kann jederzeit
Wasserstand und Temperatur des Wassers controlirt werden. In diesen Wasserbehälter
tritt gleichzeitig der vom Blechkasten abgehende Dampf, welcher dieses Wasser vorwärmt, so daſs es
gereinigt und vorgewärmt nach dem Dampfkessel abgeführt werden kann.
Hiernach stimmt dieser Apparat im Princip mit dem Nolden'schen (*1876 220 376) überein.
H. Walz in Berlin (*D. R. P. Nr. 65 vom 22. Juli 1877)
verwendet, wie aus Fig. 6 und
7 Taf. 7 näher zu ersehen, einen Kasten von Eisenblech, welcher durch die
zwei Scheidewände s in drei Räume P, Q und R abgetheilt
wird. In dem ersten Behälter P mischt sich das durch
w zugeführte Wasser mit den aus dem Behälter A zuflieſsenden Chemikalien, tritt von unten in die
zweite Abtheilung Q, steigt in dieser auf und flieſst
in den Vorrathsraum R, aus dem es gereinigt durch E zum Dampfkessel gelangt. Der abgesetzte Schlamm wird
durch die Rohrstutzen x entfernt. Der Abdampf von der
Maschine tritt durch ein Rohr bei D ein und entweicht,
soweit er nicht condensirt wird, durch d.
Eigenthümlich ist die selbstthätige Zuführung der Chemikalien. Am unteren Ende des
mit einem Regulirungshahn versehenen Rohres h ist eine
um einen horizontalen Stift drehbare Klappe angebracht, welche durch den Druck des
Gegengewichtes n das Rohr schlieſst. Mit dieser
horizontalen Verschluſsklappe ist eine nach unten gerichtete Platte verbunden, gegen
welche das von der Pumpe P durch w zugeführte Wasser strömt, dadurch h öffnet, so daſs eine entsprechende Menge der in A befindlichen Fällungsmittel zuflieſst, so lange die
Wasserzufuhr dauert. Um ferner den Wasserzufluſs zu regeln, ist in dem verlängerten
Kegel des Lufthahnes l der Wasserpumpe die
verschiebbare Stange B befestigt, welche an einem Ende
das verstellbare Gegengewicht C, am anderen das
Blechgefäſs G trägt; dieses ist leer leichter als C, aber schwerer, sobald es mit Wasser gefüllt ist.
Dieses Gefäſs steht nun mittels eines Gummischlauches mit der Abtheilung R an einer höher als das Abfluſsrohr E gelegenen Stelle in Verbindung. Steigt nun hier das
Wasser bis zur Linie ab, so geschieht dies ebenfalls im
Gefäſs G, wodurch es, schwerer geworden, nach unten in
die bestimmte tiefste Stellung fällt und hierbei den Lufthahn öffnet. Der fernere
Zufluſs des kalten ungereinigten Wassers nach dem Apparate hört auf. Sinkt nun durch
den Verbrauch des gereinigten Wassers das Niveau in R
und somit auch im Gefäſse G, bis letzteres leichter als
das Gegengewicht C geworden, so steigt es wiederum bis
zum vorgeschriebenen höchsten Stande, schlieſst dabei den Lufthahn und setzt somit
die Pumpe wieder in Thätigkeit. Das Gefäſs G ist
vollkommen wasserdicht; nur im Deckel befinden sich einige kleine Löcher, durch
welche die Luft beim Entleeren eintritt. Sie werden dagegen von einem oberhalb mit
Leder überzogenen Schwimmer, der eine Führung im Deckel erhält, beim Steigen des
Wassers wieder geschlossen.
F. HetetBulletin de la Société d'Encouragement, 1878 Bd.
5 S. 543. Der Apparat war auf der Pariser Weltausstellung an dem
Maschinenmodelle des Schiffes Dupotit Thouars
angebracht. empfiehlt zur Reinigung von fetthaltigem
Condensationswasser folgende selbstthätige Vorrichtung (Fig. 8 Taf.
7). Je nach der Menge des durch die Pumpe P aus dem
Behälter H angesaugten und in das Speiserohr T gepumpten gereinigten Wassers tritt eine bestimmte,
durch den Schwimmer in A und den Hahn R geregelte Menge in das Trichterrohr E, durch welches Kalk eingeführt wird. Das gebildete
Kalkwasser steigt in K auf und gelangt durch das Rohr
D und den zweiten Regulirapparat B in den Condensator C.
Der nicht gelöste Kalk wird durch den Stutzen U
entfernt.
Soll das Wasser auf Schiffen zum Trinken verwendet werden, so läſst man dasselbe
zugleich mit dem Kalkwasser zusammen in das Trichterrohr a (Fig. 9)
einflieſsen. Während des Aufsteigens in der mit entsprechenden Scheidewänden
versehenen ersten Abtheilung c mischen sich die beiden
Flüssigkeiten, durchflieſsen in der Richtung der Pfeile die übrigen mit Kohle
gefüllten Abtheilungen des Filters und treten gereinigt durch s aus. Am Boden des Filters sind Reinigungshähne
angebracht.
Die Chemische Fabrik Eisenbüttel in Braunschweig
empfiehlt in einer Flugschrift die Reinigung des Speisewassers mit Soda und
Kalk:
Nachdem die zur gänzlichen Ausfällung des Wassers nöthige Menge
von Kalk und reinem kohlensaurem Natron aus der Analyse des Wassers berechnet oder
durch einen praktischen Versuch im Laboratorium festgestellt wurde, wird dem
möglichst hoch (etwa auf 60°) vorgewärmten Wasser im Fällungsbehälter zuerst Kalk
als dünne Kalkmilch zugesetzt und umgerührt und zwar so viel, bis empfindliches
rothes Lackmuspapier nach wiederholtem Umrühren des Wassers, etwa ¼ Minute nach dem
Eintauchen, eben anfängt, bläulich zu werden. Sodann gibt man das in heiſsem Wasser
im Blecheimer gelöste reine kohlensaure Natron zu und rührt abermals kräftig um.
Nach 20 bis 30 Minuten (je wärmer das Wasser, desto rascher die Fällung) hat sich
der entstandene Niederschlag vollständig in groſsen Flocken zu Boden gesetzt und das
klare Wasser wird in den Reinwasserbehälter abgelassen. Wird das Wasser nicht
vorgewärmt, so dauert die Klärung länger.
Im Anschluſs hieran mögen noch einige andere die Sicherheit der Dampfkessel
betreffende Mittheilungen Platz finden.
TichborneChemical News, 1878 Bd. 38 S.
191. berichtet über die Zerstörung der Dampfkessel durch das
Wasser des Vartry-Flusses. Hiernach werden die Nitrate des Speisewassers in Nitrite,
diese in Hydrate und Stickoxyd zersetzt, welches angeblich nach folgender Gleichung
Fe + 2NO = FeO + N2
O die Kesselbleche stark oxydirt (vgl. 1878 230
44).
Sicherheitspfropfen. A. F. O. Budenberg in Manchester
(*D. R. P. Nr. 1249 vom 31. Juli 1877) hat sich einen schmelzbaren
Sicherheitspfropfen patentiren lassen, welcher sich von den bisherigen dadurch
unterscheidet, daſs er sicherer wirkt und leichter ausgewechselt werden kann.
Die Sternberger Maschinenbauanstalt (*D. R. P. Nr. 530
vom 1. August 1877) verwendet eine solche leicht schmelzbare Legirung für ihren
thermischen Siedeverzugsanzeiger (Fig. 10
Taf. 7). Derselbe besteht aus einem genügend weiten Rohre, welches, von einer
höheren Stelle des Dampfraumes ausgehend, eine möglichst niedrige, dem Feuer direct
ausgesetzte Stelle des Kesselwassers berührt, um an einer passenden Stelle des
Dampfkessels auszumünden. An dem äuſseren Ende trägt das Rohr eine Dampfpfeife, bei
a hat es eine Verengung, in welcher ein Pfropfen
von entsprechender Leichtschmelzbarkeit den Durchgang des Dampfes verschlieſst.
Sobald durch den eingetretenen Siedeverzug das Wasser im Dampfkessel heiſser wird
als der über demselben befindliche Dampf, schmilzt der Pfropfen und gewährt dem
Dampfe freien Austritt aus der Dampfpfeife. Die bisherigen Erfahrungen sprechen
nicht besonders zu Gunsten derartiger Sicherheitsvorrichtungen.
F.
Tafeln